Sinneslehre
(Aus: Thomas Göbel 1982 – die Quellen der Kunst – Lebendige Sinne und Phantasie als Schlüssel zur Architektur)
… Das reicht bereits, um die allgemeinen Bedingungen der Wahrnehmung zu formulieren. Zur Wahrnehmung müssen zusammenwirken: die Wahrnehmungsgegenstände, gesunde Sinnesorgane und eine die Sinneswerkzeuge ergreifende Seele. Wir dürfen nicht ausser acht lassen, dass die Sinnesorgane dem physischen Leib angehören, die Seele aber zu einer Seelenwelt gehört. Die Seele muss über einen dem Leibe zugewendeten Teil verfügen, mit dem sie sich in die Sinnesorgane hineinbegeben kann. Diesen Teil der Seele hat Rudolf Steiner «Seelenleib» genannt. Durch diesen Seelenleib erst wird die Sinnesempfindung in der Seele wach.
Eine zweite Art der Unterscheidung lässt sich treffen, wenn wir beobachten, aus welchen Phänomengruppen sich das geschilderte Ganzheitserlebnis der Naturbeobachtung zusammensetzt. In der Reihenfolge, in der das Naturerlebnis geschildert wurde, finden wir Farben, Begriffswahrnehmungen, Gestalten, Eigenbewegungen, Tasterlebnisse, Gerüche, Wärmeerlebnisse, Hörerlebnisse. Vom Ganzen der Sinneserfahrung her gesehen, ist das selbstverständlich eine unvollständige und in der Reihenfolge zufällige Aufzählung. Wir können uns nun darauf besinnen, dass jede Wahrnehmungsart, wie das Farbensehen, eine ganze Reihe von Qualitäten umgreift, zum Beispiel Rot und Grün. Diese unterscheiden sich – das ist unmittelbar einzusehen – prinzipiell von anderen Wahrnehmungsarten, zum Beispiel von den Tönen. Das Seelenorgan, das die Summe aller Farbqualitäten auffasst, soll «Sehsinn» genannt werden, dasjenige für die Hörerlebnisse «Hörsinn» und so weiter. «Sinn» heisst in unserer Betrachtung daher ein Seelenorgan, das für eine bestimmte Qualitätsart der Sinneswelt offen ist. Es wird sich zeigen, dass der Mensch zwölf solcher Sinne hat, die zusammen einen Teil seiner Seele bilden. Rudolf Steiner bezeichnete diesen Teil als «Empfindungsseele“.
Die Gefühlssinne
Der Sehsinn
Der Sehsinn
Wenn wir den Blick auf einen Baum richten, so müssen die folgenden Faktoren zusammenwirken, damit dieses Erlebnis zustande kommt: das Wahrnehmungsobjekt «Baum», die Sinnesorgane «Augen», der in die Augen ragende «Empfindungsleib», die «Empfindungsseele» und das wache «Ich», das den Blick auf den Baum richtet, dabei die genannten Seelenglieder und das Auge als Werkzeug gebrauchend. In der so entstehenden einheitlichen Wahrnehmung lassen sich mehrere Qualitätsfelder der Empfindungsseele unterscheiden: eine «begriffliche», die Baum zum Inhalt hat, eine «gestaltliche», die die Form, und schliesslich eine dritte, die die Farben zwischen Hell und Dunkel wahrnimmt. Nur auf die Phänomene, die mit der Farbenwelt zu tun haben, soll im folgenden geblickt werden. Erst wenn auf diese Weise alle Sinne betrachtet sind, wollen wir darauf zurückkommen, wie die einzelnen Sinne zur Ganzheit der uns gegebenen Sinneswelt zusammentreten. Die Erscheinungen des Farbigen in ihrer ganzen Vielfalt überblickend, lassen sich zwei Phänomengruppen durch den verschiedenen Gebrauch des Auges unterscheiden: einmal die Körperfarben an den Oberflächen der Gegenstände. Hier finden wir nur ausnahmsweise reine Farben. In der Regel wirken sie erdig und gebrochen. Ihre Erscheinung ist dadurch charakterisiert, dass sie fixierbar sind und in der Textur der Oberfläche erscheinen, an der sie gesehen werden. Zum anderen unterscheiden wir die Lichtfarben. Diese finden wir in der Natur als Himmelsfarben. Selten sind sie gebrochen, und nie wirken sie erdig. Mit den Augen sind sie nicht fixierbar und erscheinen daher auch nie als Oberflächen. Dass Farbe und Oberflächentextur zwei verschiedene Dinge sind, lässt sich im Experiment zeigen: man blicke auf eine beleuchtete farbige Wand, diese fixierend. Dann halte man die Hand mit gespreizten Fingern in 30 cm Abstand vor die Augen und fixiere die Finger. Dabei beobachte man, wie sich die Wand verändert. Die Textur der Wandoberfläche ist verschwunden, und die Farbe bekommt den Charakter einer Lichtfarbe. Wir entdecken dabei, dass die Leuchtkraft oder Lichtartigkeit der Farbe in dem Masse zunimmt, wie die Merkmale der gegenständlichen Raumwelt und wie Oberflächentextur und Gegenstandsgrenzen abnehmen. Daher sind Farberlebnisse als isoliertes Sinnesphänomen am reinsten an den Himmelsfarben wahrzunehmen. Man blicke an einem wolkenfreien Tag so nach oben, dass der Horizont nicht in das Blickfeld ragt. Was dann noch an Differenzierung des Himmelsblau übrigbleibt, liegt in der Farbe selbst: zum Zenit hin wird das Blau dunkler, zum Horizont heller. Das deutet auf die Grenzen der leuchtenden Farbe, die sich unmerklich in die tiefste Dunkelheit oder die strahlendste Helle verlieren kann. Das ist der Fall, wenn es Nacht wird oder wenn man den Blick langsam zur Sonne wendet. Ausser der blauen Himmelsfarbe gibt es die Dämmerungsfarben, die am Morgen oder am Abend in der weiteren Umgebung der Sonne oder selten auch am Gegenhimmel zu beobachten sind. Dabei scheint charakteristisch zu sein, dass die Sonne selbst die grösste Farbintensität zeigt und dass der Rand der Sonnenscheibe scharf zu sehen ist. Der scharf erscheinende Sonnenrand erscheint immer, wenn die Sonnenscheibe farbig ist, und er verschwindet, wenn die Sonnenscheibe grau wird, was bei Nebel der Fall ist oder wenn die Sonne durch dünne Wolken scheint, wenn Wolken[-]striche oder -fetzen über die Sonne ziehen. Nun verschwimmt der scharfe Rand, und die Sonne scheint grau durch die Wolke. Das macht darauf aufmerksam, dass die von Goethe sogenannte «Trübe», durch die eine Lichtquelle rot erscheint, einen bestimmten physikalischen Zustand haben muss, der «kolloidal» genannt wird. Dieser Substanzzustand ist weder eine Lösung noch ein Gemenge. Er hält dazwischen – und zwar unter bestimmten Bedingungen – stabil die Mitte; er ist der Zustand aller lebenden Substanz.
Die Dämmerungsfarben zeigen uns hauptsächlich gelbe, orange und rote Töne, nur manchmal kommt Eisblau und Seegrün dazu. Dass die Dämmerungsfarben auch in ein tiefes Violett (nicht nur Purpur) übergehen, ist sehr selten zu beobachten, deshalb beschreiben wir ein solches Erlebnis: Im Moment des Sonnenunterganges war der Himmel gelb, orange und rot im kontinuierlichen Übergang gefärbt. Das Rot lag dem Horizont auf Plötzlich quoll ein dunkles Violett vom Horizont auf und drängte Rot bis Gelb nach oben, wobei diese zunehmend schmaler wurden, bis schliesslich ein breites tiefes Violett unter einem sehr schmal gewordenen rötlichen Band stand, ehe das ganze Phänomen erlosch.
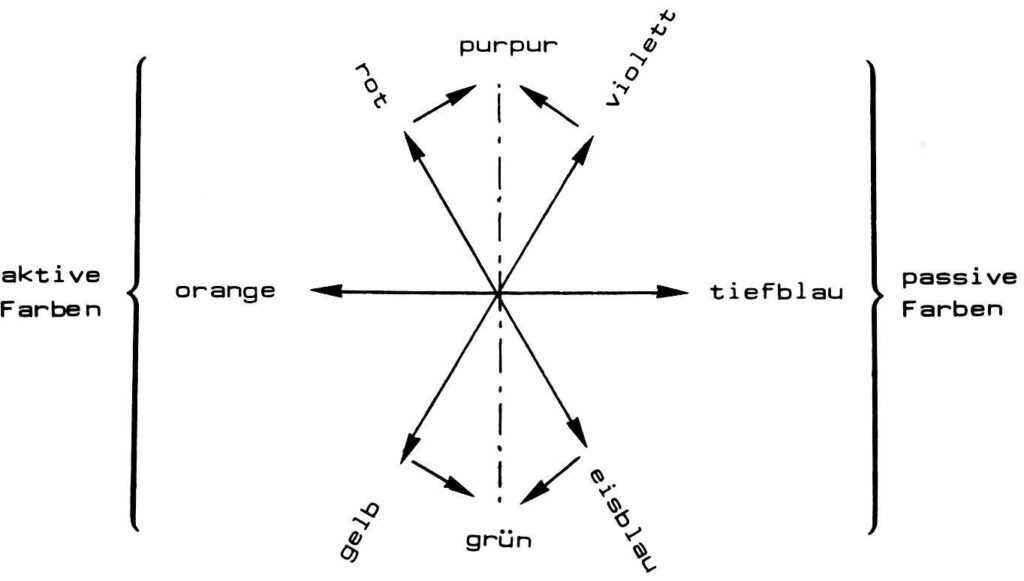
Eine zweite Art von Lichtfarben erscheint, wenn wir durch ein Prisma blicken. Wird es so gehalten, dass eine Kante nach oben und eine Seite nach unten weist, erscheinen an den Grenzen dunkler Flächen Farbsäume so, dass über der dunklen Fläche ein rot-orange-gelber Farbsaum, unter ihr ein Violett- Tiefblau-Eisblau erscheint. Sind schwarze Linien auf hellem Untergrund so angeordnet, dass sich die entstehenden Farbsäume überdecken, entsteht Purpur und Grün im Wechsel. (An diese bekannten Experimente soll hier nur erinnert werden.) Die prismatischen Versuche zeigen, wie sich die Lichtfarben sachgemäss so ordnen lassen:
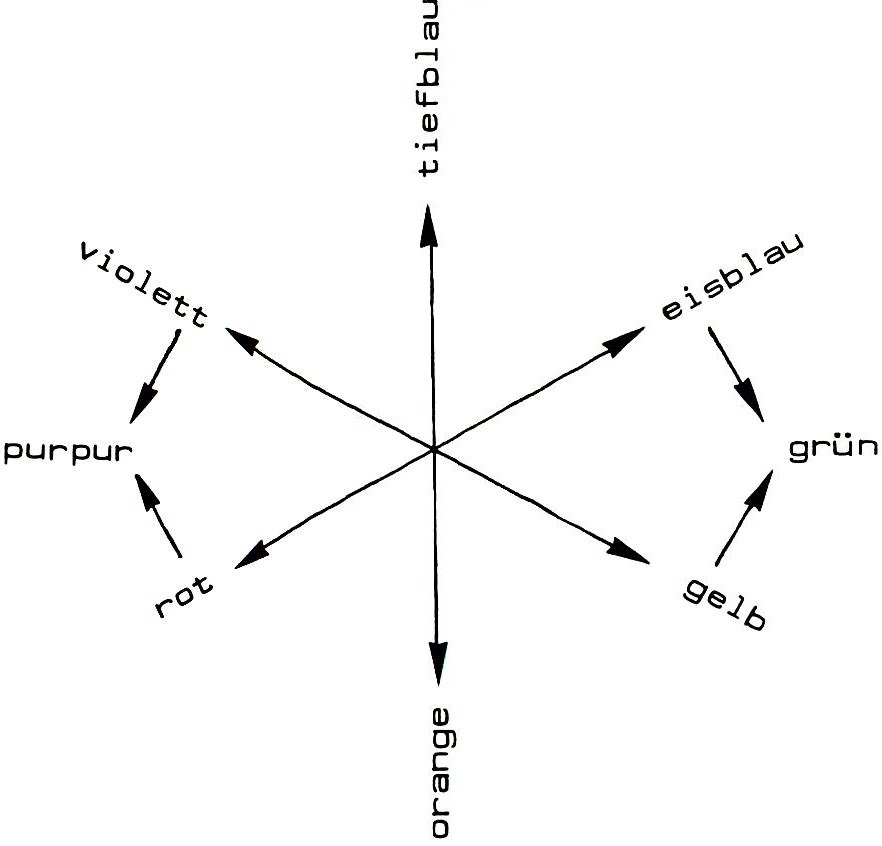
Wir können von sechs Lichtfarben sprechen, drei auf der Seite passiver, drei auf der Seite aktiver Farben. Wo sie sich begegnen, ist Steigerung zu Purpur und Grün möglich. Damit haben wir auch ein Spektrum des Sehsinns gefunden, denn diese Anordnung enthält alles, was der Sehsinn in den Phänomenen der Lichtfarben wahrnehmen kann. Lediglich der Übergang in strahlende Helle oder tiefe Finsternis ist im Schema nicht enthalten.
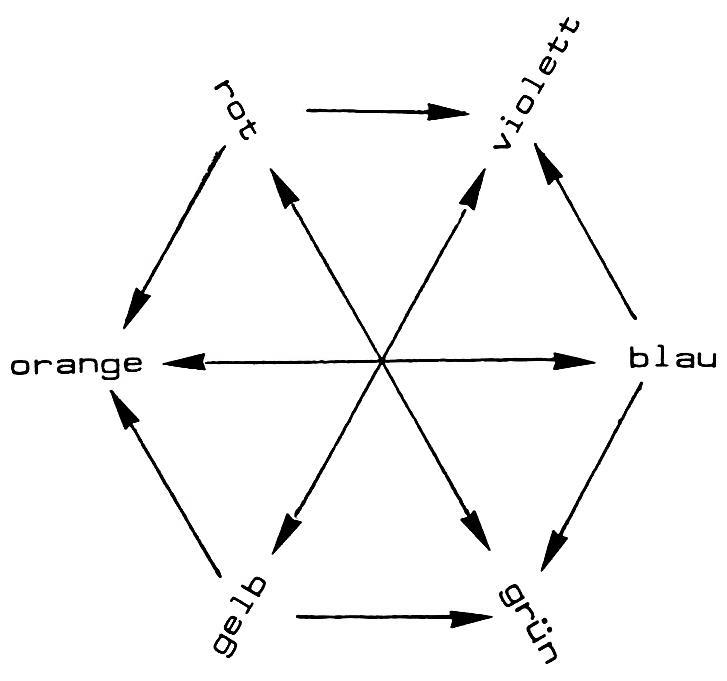
Der experimentelle Umgang mit Körper- oder Pigmentfarben zeigt, dass wir ihr Spektrum gesondert zu betrachten haben. Mit Pigmentfarben kann man überhaupt nur so umgehen, dass man sie mischt. Daher scheint die erste Frage zu sein, welche Farben durch Mischung entstehen und welche gegeben sein müssen. Rot, Gelb und Blau lassen sich nicht aus anderen Pigmentfarben mischen – jedoch Orange, Grün und Violett. Soll mit dieser Unterscheidung ein Spektrum gebildet werden, hätte es folgendermassen ausgesehen:
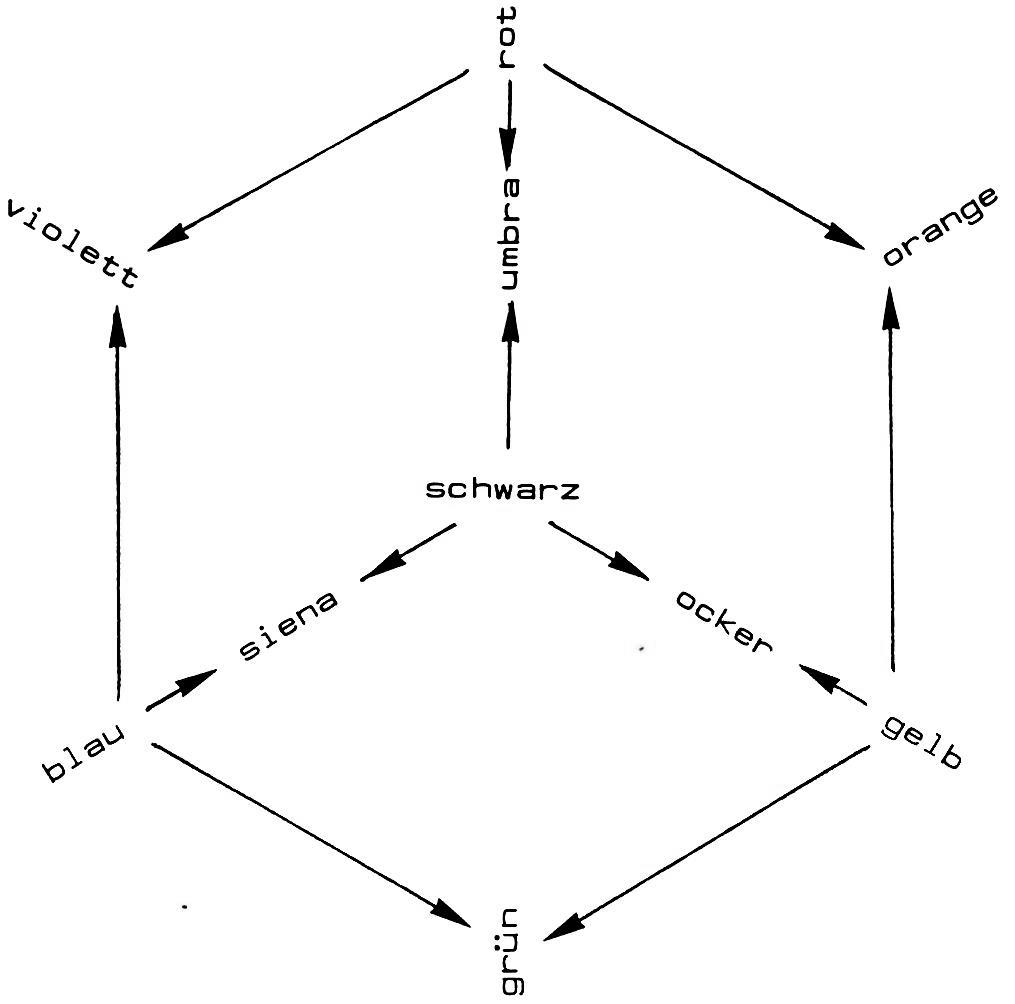
Zwischen die Primärfarben Rot, Gelb und Blau sind die jeweiligen Mischfarben gestellt. Allerdings sind aus diesem Spektrum nicht alle Möglichkeiten der Mischung zu erkennen. Es lassen sich, um eine weitere zu nennen, die drei Primärfarben zu Grau verbinden. Das Grau selber kann sich bis zu Schwarz verdunkeln und zu Weiss erhellen. Schwarz und Weiss sind demnach ebenfalls als Mischfarben zu bezeichnen. Sind sie das, muss man mit ihnen wieder die Primärfarben mischen und sie dabei stufenlos in Weiss oder Schwarz überführen können. Untersucht man diese Frage experimentell, findet man alle Brauntöne, wenn in Schwarz gemischt wird und eine Farbe dabei überwiegt. Überwiegt Rot, entsteht Umbra, überwiegt Gelb, entsteht Ocker und durch das Überwiegen des Blau Siena. Unser Schema eines Spektrums lässt sich damit folgendermassen erweitern.
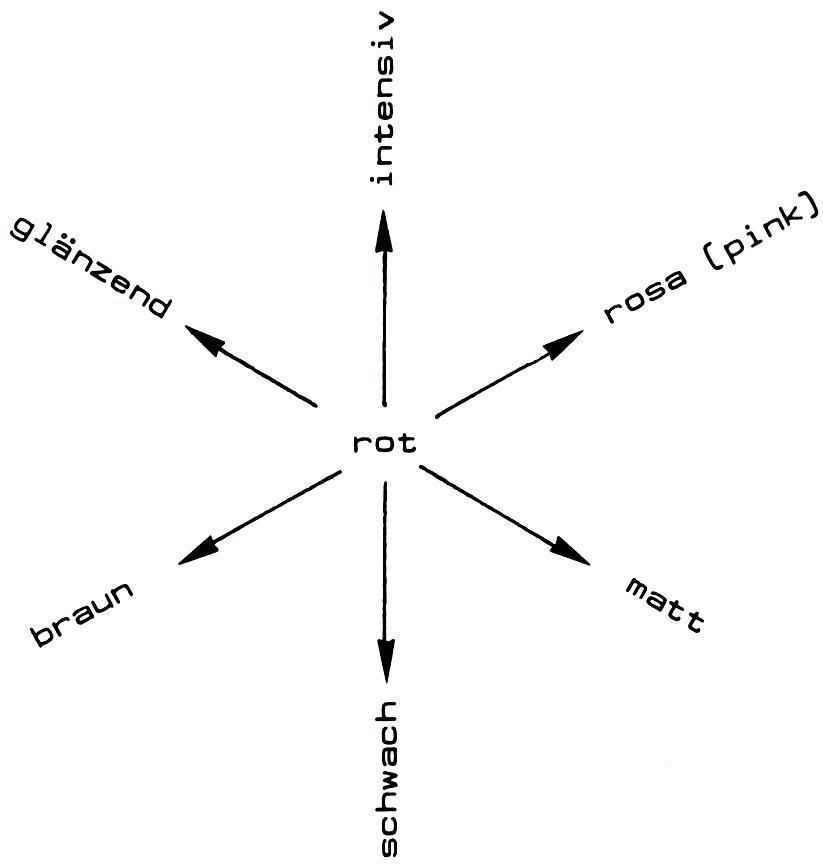
Aber auch einzeln lassen sich die Farben in Schwarz einmischen. Dabei ergeben sich qualitative Tonverschiebungen. Mischt man Rot ein, entsteht ebenfalls Braun. Das Gelb ergibt einen grauen Olivton, ehe es in Schwarz übergeht, und das Blau wird zu einem dunklen Taubengrau. Durch Weiss als Einmischfarbe entsteht Rosa (Pink) aus Rot, Milchblau durch Blau und Gelb wird Creme.
Eine weitere Mischmöglichkeit besteht darin, das Lösungsmittel zu wechseln. Durch Öl bildet sich eine glänzende Oberfläche, durch Wasser eine matte. Schliesslich kann das Pigment selbst eine höhere oder eine geringere Farbintensität zeigen. Diese ganze Vielfalt weist daraufhin, dass sich die Variationen jeder einzelnen Farbe zu einem Spektrum ordnen lassen. Im folgenden Beispiel für eines dieser Spektren sind die Mischungsverfahren, die zur entsprechenden Variation führen, nicht mit angegeben:
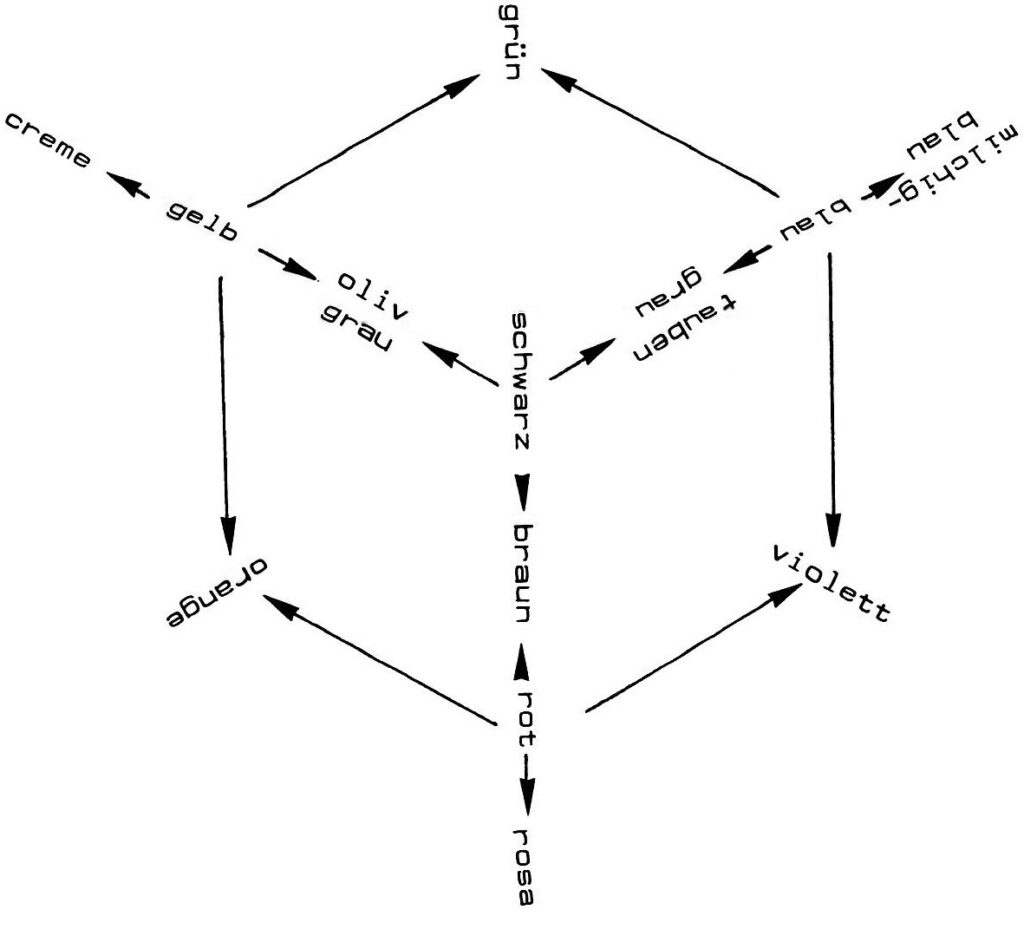
Wir stellen abschliessend die Spektren des Sehsinnes noch einmal nebeneinander. Im Spektrum der Körperfarben ist diesmal die Mischung der Einzelfarben in Schwarz und Weiss angegeben.
Die reinen Lichtfarben des Himmels beherrschen die kosmischen Phänomene des Tages und der Dämmerungen. Sie stehen den an die Körper der Gegenstandswelt gebundenen Farben gegenüber. Die Brauntöne als Höhepunkt der gemischten Pigmentfarben beherrschen den Boden der Erde. Die grüne Pflanzenwelt vermittelt in der Natur zwischen beiden Erscheinungen. Eine wohlgeordnete Farbwelt steht vor unserem Blick, die das Auge als Instrument des Sehsinnes der Seele gibt.
Will man das seelische Verhältnis bestimmen, das man zu den Farben gewinnen kann, lässt sich zuerst nach dem Unterschied der Wirkung von Licht- und Körperfarben fragen. Dazu besinnen wir uns auf die schon besprochene Tatsache, dass die Lichtfarben nicht fixierbar sind. Das führt dazu, dass die Seele sich ihrer Wirkung unmittelbar hingeben kann. Der Betrachter fühlt sich in das Farbenmeer hineingezogen, von ihm aufgenommen und spürt, wie er sich selbst darin verlieren kann. Der Wirkung einer farbigen Fläche steht man dagegen distanzierter gegenüber. Das Ich fixiert beobachtend und für die Nuancen wach werdend. Zu den Lichtfarben entwickelt die Seele eine mehr sympathisch-träumende, zu den Körperfarben eine mehr antipathisch-aufwachende Beziehung. Das ist auch zwischen passiven und aktiven Farben so. Besonders Rot geht dem Betrachter entgegen, in Blau kann er sich hineinbegeben. Der Farbsinn bindet vor allem die fühlende Seele an die Sinneswelt, sie in Sympathie weitend oder in Antipathie zusammenziehend.
Überblickt man die Ordnung aller Sinne, so liegt der Sehsinn in der Mitte. Es ist naheliegend, drei weitere Sinne zu behandeln, die mit dem Sehsinn insofern verwandt sind, als sie in ihren Spektren wie er je sechs Urphänomene aufzuweisen haben und wie er primär das Gefühl affizieren.
Der Geruchssinn
Der Geruchssinn
Den Reigen der Gerüche deutlich gegeneinander abzugrenzen, ist nicht einfach. Wir kennen, um mit einem Phänomen zu beginnen, an welches man sich leicht erinnert, einen scharf-stechenden Geruch, wie er zum Beispiel vom Ammoniak ausgeht. (Mit der Bezeichnung «scharf-stechend» wurde zu einem Doppelwort gegriffen, weil es hier keine so festen Begriffe gibt wie beim Sehsinn. Die die Gerüche bezeichnenden Wörter stammen mehr aus einem charakterisierend-beschreibenden Verhältnis zum Phänomen als aus einem definitorisch-abstrakten. Aus diesem Grunde sollen auch weiterhin hinweisende Doppelwörter gebraucht werden.)
Einen anderen Geruch findet man, wenn im Herbst nach dem Laubfall die Walderde riecht, die man aus der oberen Bodenschicht geholt hat. Hier können wir von moderig-erdig sprechen. Beiden Gerüchen, dem stechend-scharfen wie dem moderig-erdigen, steht die Seele mehr antipathisch gegenüber. Die Antipathie aber kulminiert, wenn es stinkend-faulig riecht. Und bei hoher Intensität kann sich die Antipathie, die dieser Geruch erzeugt, bis zur leiblichen Übelkeit steigern. Mehr mit Sympathie antwortet die Seele auf süsslich-schwere und säuerlich-fruchtige Gerüche. Den ersteren erleben wir beispielsweise am Pfeifenstrauch oder falschen Jasmin, den letzteren, wenn wir an gärenden Früchten riechen. Die Mitte hält hier der duftend-blumige, der sympathischste aller Düfte, wie ihn Osterglocke oder Narzisse verströmen. Wegen der engen Bindung seelischer Reaktionen an Gerüche scheint es schwer, Mischgerüche von reinen zu unterscheiden; um einige sympathische zu nennen: aromatisch, würzig, frisch – und einige antipathische: muffig, moschusartig, brenzlig. Auch wenn nur einfache Wörter für diese Gerüche gebraucht werden, scheinen sie doch die zusammengesetzten Mischgerüche zu sein. «Aromatisch» setzt sich aus den Hauptkomponenten duftend-blumig und süsslich-schwer zusammen. «Würzig» aus stechend-scharf und einem oder mehreren der sympathischen Düfte. «Frisch» aus säuerlich-fruchtig mit duftig-blumiger Note. Noch komplizierter wird die Sache, wenn ganz charakteristische und gut bekannte Düfte wahrgenommen werden. Sie sind am ehesten definierend zu beschreiben, beispielsweise: wie Maiglöckchen- oder Veilchenduft. So eindeutig solche Gerüche durch die Wahrnehmung zu erkennen sind, so schwierig ist es, die Vielzahl ihrer Komponenten auseinanderzuhalten.
Zwei Pole, zwischen denen sich die Palette aller Gerüche aufspannt und in die sie wie die Farben in Hell und Dunkel verschwinden, konnten nicht gefunden werden, was nicht heissen soll, dass es sie nicht gibt. Wohl aber sind Intensitätsgrade deutlich zu beschreiben. Befasst man sich mit diesen, bemerkt man, dass es im Sprachgebrauch keine für alle Gerüche in gleicher Weise verwendeten Begriffe gibt wie «schwach» und «intensiv» oder «grell» für die Farben. Hier sind die Bezeichnungen an einzelne Gerüche gebunden. Bei «süsslich-schwer» unterscheidet man zwischen «leicht» und «betäubend» duftend, bei «säuerlich-fruchtig» zwischen «zart» und «stark», bei «stinkend-faulig» zwischen «kaum» und «penetrant». Die Intensität wird stark mit der Geruchsqualität verbunden erlebt, was zu einer weiteren Differenzierung der Erlebnisskala führt. Daher wird die gleiche Geruchsqualität oft als eine neue empfunden, wenn sie mit anderem Intensitätsgrad auftritt.
Bei der Besprechung der Phänomene des Sehsinnes haben wir bemerkt, dass das Farbige sinnlicher Ausdruck einer seelischen Welt ist. Was drückt sich in den Phänomenen des Geruchs aus? Eine Antwort findet sich, wenn wir beobachten, unter welchen Bedingungen sich in der Pflanzen- wie in der Tierwelt Gerüche besonders stark entwickeln. Die Blüten der Pflanzen emanieren charakteristische Gerüche, die aus den genannten Urphänomenen komponiert sind. Der Duft der Blüte korreliert mit den Blühfarben, dem Geschmack des Nektars, dem Zerstäuben des Pollens und schliesslich der Blütengestalt. In diesen die Blüte charakterisierenden Erscheinungen zeigt sich die Wirkung eines Seelischen, das die Pflanze von aussen, sozusagen transzendent berührt. Im Erlebnis des Blütenduftes offenbart sich die paradiesische Unschuld seelischer Wirkungen, die aus dem Umkreis kommen. Dieses Seelische bringt aber der Pflanze den Tod. Denn spätestens nach der Fruchtreife sterben alle vom Blühimpuls ergriffenen Pflanzenorgane. Mit der Blüteninduktion endet alles fortschreitende (proliferierende) Pflanzenwachstum.
Endgestalten, die sterben müssen, werden ausgebildet. Der Blütenduft erscheint also, wenn ein seelischer Bildeimpuls die Pflanze todbringend von aussen berührt. Ähnlich verhält es sich beim Tier. Stirbt es, so entfaltet der Kadaver seinen Gestank. Auch hier ist es der Tod, den man riecht. Unschuldig können wir das Tier wegen seiner inkarnierten Begierden nicht mehr nennen. Das offenbart der Gestank, der im Gegensatz zum Blütenduft die menschliche Seele antipathisch berührt.
Der Tod berührt das Wesen von aussen:
duftend-blumig
∧
∨
stinkend-faulig
Der Tod ergreift das Wesen von innen.
Nun kann im Pflanzenreich der duftend-blumige Geruch in zwei Richtungen abgewandelt werden. Einmal kann die Blüte in Gestalt und Biologie Beziehungen zur Insektenwelt zeigen wie zum Beispiel bei den Erdorchideen (Ophrysarten) Süd- und Mitteleuropas. Das Seelische, das den Tod bringt, ist einem Innerseelisch-Tierischen soweit ähnlich geworden, wie es einer Pflanze irgend möglich ist. Jetzt verwandelt sich der Blütenduft in einen süsslich-schweren Geruch. Polar dazu der stinkend-faulig riechende Tierkadaver: in dem Masse, wie das aggressive Innerseelische aus dem Verwesungsprozess verschwindet, verwandelt sich der Geruch zum Moderig-Erdigen.
Der Tod berührt eine sich dem Innerseelischen zuneigende Pflanze:
süsslich-schwer
∧
∨
moderig-erdig
Endphase der Tierverwesung, in der das Innerseelische verflogen ist.
Die zweite Richtung, in die sich das Duftend-Blumige wandeln kann, finden wir, wenn sich nach der Blühphase die Fruchtreife entwickelt. Hier tritt die seelische Wirkung zurück, und die Lebenskräfte überwiegen, ehe der Tod eintritt. Der Geruch verwandelt sich zum Säuerlich-Frischen, einer Komponente, die man an Äpfeln, überhaupt an Obst findet. Wirkt die tötende Kraft des Seelischen im Tiere nicht so stark, dass sie den Tod bringt, dann trägt sie Abbauvorgänge in den Tierorganismus. Deren Stoffwechselprodukte werden als Harn ausgeschieden, der stechend-scharf riecht.
Das Lebendige überwindet das von aussen tötende Seelische:
säuerlich-frisch
∧
∨
stechend-scharf
Das Lebendige überwindet das von innen abbauende Seelische.
Süsslich-schwer, duftend-blumig und säuerlich-frisch: so sind die Gerüche auf der Seite des Spektrums, die dadurch zustande kommt, dass die tötenden Seelenwirkungen die Pflanze mehr oder weniger überwinden. Stechend-scharf, stinkend-faulig und moderig-erdig: dieses Geruchsspektrum entsteht, wenn der Tierorganismus vom Innerseelischen mehr oder weniger getötet wird. Die den Tod in die Welt bringenden Seelenwirkungen riechen wir.
In ein Schema gebracht, lässt sich das Spektrum des Geruchssinnes folgendermassen darstellen:
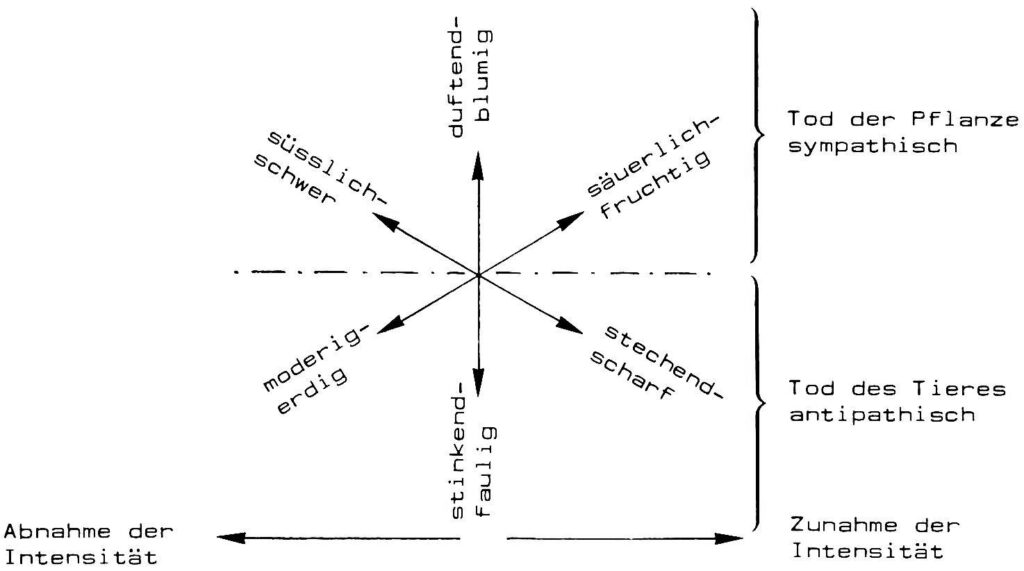
Der Geschmackssinn
Der Geschmackssinn
Zum Schmecken gehört, dass wir die festen oder flüssigen Substanzen der Umwelt mit unserem eigenen Leib in Berührung bringen. Ohne die Substanzen mit der Zunge zu berühren oder ganz in den Mund zu nehmen, erleben wir keinen Geschmack. Dann aber lassen sich «süss», «salzig»,«sauer» sofort und deutlich voneinander unterscheiden. Waren es beim Riechen die drei antipathischen Gerüche, die wir besser kannten als die sympathischen, so ist es hier gerade umgekehrt. Dem Süssen, dem Salzigen und dem Sauren bringen wir, wenn sie nicht zu intensiv auftreten, Sympathie entgegen. Der bittere Geschmack ist der nächste, auf den man sich besinnen kann. Er scheint dem süssen polar gegenüberzustehen. Wir kommen weiter, wenn wir nach der Polarität des sauren Geschmackes fragen. Dieser Geschmacksempfindung steht das Seifig-Basische gegenüber, dem salzigen Geschmack der herbe. Gemeint ist der meist mit einem Zusammenziehen der Schleimhäute verbundene Geschmack, wie ihn die unreife Schlehe mit hoher Intensität erzeugt. Alle sechs genannten Geschmacksqualitäten können nun zwischen «fein» und «mild» einerseits und «grob» und «aufdringlich» andererseits ihre ganze Intensitätsbreite entfalten. Ähnlich wie bei den Farben scheinen die Geschmackspolaritäten sich gegenseitig auszulöschen oder sich zumindest gegenseitig zu mildern. Dazu muss man die schmeckenden Substanzen mischen. Am deutlichsten ist das zwischen «seifig» und «sauer» der Fall. Ein herber Geschmack lässt sich durch Salz zumindest mildern, während «bitter» und «süss» eher eine Kombination bilden, bei der beide Komponenten, wenn auch gemildert wahrzunehmen sind, wie man durch das Einnehmen bitterer Arznei auf Zucker weiss. Da «seifig» der einzige Geschmack ist, dem auch in der Kombination mit anderen Komponenten keine sympathische Empfindung abgewonnen werden kann, könnte man erwägen, von fünf mehr oder weniger – zumindest in der Komposition mit anderen Geschmacksarten – sympathischen Phänomenen des Geschmacks zu sprechen. Aus diesem Grunde verzichten wir bei der schematischen Darstellung des Spektrums auf das Verhältnis von Sympathie und Antipathie zu diesem.
Nun gibt es Sinnesempfindungen, die durch eine Kombination zwischen Geruchs- und Geschmackswahrnehmungen entstehen. Da gibt es beispielsweise dasjenige, was wir «ranzig» nennen. Um was es sich handelt, kann man am besten im Experiment herausfinden. Man nehme dazu ranzige Butter und rieche zuerst nur daran, halte sich alsdann die Nase zu und probiere davon. Ist man sich über den Geruch und Geschmack der ranzigen Butter getrennt klar geworden, öffne man die Nase und koste noch einmal. Was sich jetzt ergibt, ist eine dritte, von den beiden vorangegangenen deutlich verschiedene Wahrnehmung.
Fragen wir schliesslich nach der Schicht der Welt, die sich durch den Geschmackssinn dem Menschen offenbart. Wir erinnern uns, dass es das Wasser ist, in dem sich die Fülle der schmeckenden Substanzen gelöst haben muss, damit sie schmeckend wahrgenommen werden können. Das Wasser ist überhaupt das Element, durch das und in dem chemische Prozesse vorzugsweise ablaufen; ausserdem ist es die Grundlage aller Lebensvorgänge. Die chemischen Prozesse, die von Lebensvorgängen betrieben werden, sind an das Wasser im Organismus gebunden, und deshalb wird uns auch ein geeigneter Organismus Aufschluss geben können, wie die Geschmacksstoffe entstehen und sich entwickeln. Am geeignetsten scheinen die Obstgewächse zu sein, wenn sie nach der Blüte ihre Früchte entwickeln. Unreife Äpfel schmecken sauer. Die Schlehen haben vor der die Süsse bringenden Vollreife, die sich erst nach den ersten Frösten im Spätherbst oder Winter entwickelt, eine Phase, in der sie besonders herb schmecken. Manche Früchte, die nicht süss werden, bleiben auf der herben Stufe stehen wie beispielsweise die Eicheln, die Früchte von Eberesche, Mehlbeere und Speierling. Geht die Fruchtreife in Fäulnis über, wird der Geschmack fade. Einen faden Geschmack fmdet man aber auch, wenn man kostet wie Rinde, Bast, sogar manchmal Holz schmeckt. Salzgeschmack findet sich in Wurzeln und in allen sukkulenten (wasserspeichernden) Organen der Pflanze. Zum Beispiel Selleriewurzeln haben einen leicht salzigen Geschmack. Auch die Bitterstoffe entwickeln sich vornehmlich in Wurzelorganen, wie der gelbe Enzian zeigt. Da Wurzelkräfte bis in die Blüte aufsteigen und Blüten-Frucht-Kräfte bis in die Wurzel der Pflanze hinab wirken können, überschneidet sich im Einzelfall manches. Aber auf den zugrunde liegenden Typus wird doch gedeutet, wenn man zeigt, dass «sauer», «herb» und «süss» die Geschmacksarten sind, die die Lebensprozesse der Pflanze unter der Wirkung kosmischer Kräfte, der Wärme und dem Licht der Sonne, hervorbringen. Unter der Wirkung der terrestrischen Kräfte, die aus dem Humus und dem Wasser des Bodens wirken, entfalten sich fade, salzige und bittere Geschmacksstoffe. Das folgende Schema fasst das Gesagte zusammen.
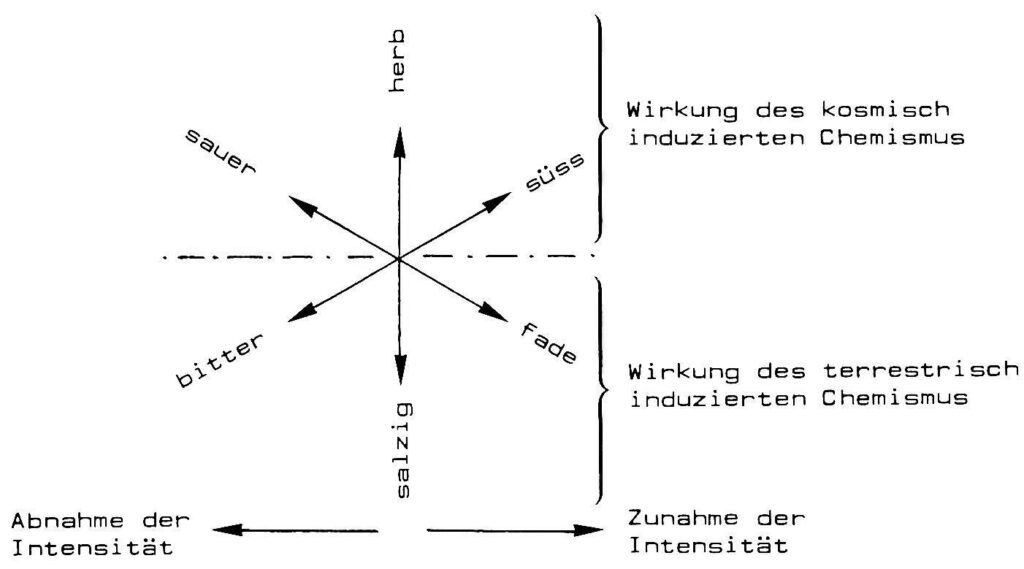
Der Wärmesinn
Der Wärmesinn
Um das Sinnesfeld kennenzulernen, in dem die Wärmewahrnehmungen auftreten, wollen wir uns darauf besinnen, wann wir warm und wann wir kalt empfinden. Das ist beispielsweise der Fall, wenn wir im Sommer aus einem kühlen Keller ins Freie treten oder im Winter aus der warmen Stube in die klirrende Frostnacht. Es ist also vor allem der Übergang von einer Temperatur in eine andere, worauf unser Wärmesinn antwortet. Dieses Übergangserlebnis tritt nur dann isoliert und losgelöst von weiteren Empfindungen des Wärmesinns ein, wenn die Temperaturen verschieden warmer Räume zwischen etwa +18°und +28° C liegen. Nach dem Wärme- oder Kälteerlebnis beim Übergang tritt sehr bald ein Abklingen der Wahrnehmung ein, auch wenn man sich bemüht, für das Erlebnis wach zu bleiben.
Gehen wir diesem Phänomen mit Hilfe eines Experimentes nach: man nehme drei gleich grosse Töpfe, die etwa drei Liter Flüssigkeit aufnehmen können. Den ersten fülle man mit drei Liter möglichst kaltem, den zweiten mit ebensoviel auf 40°C erhitztem Wasser. (Das ist eine Temperatur, bei der man gerade noch hineinfassen kann.) Dann giesse man aus dem Topf mit heissem und dem mit kaltem Wasser je einen Liter in den dritten Topf. Die linke Hand halte man in den Topf mit kaltem Wasser, die rechte in den mit heissem. Nach etwa einer Minute bringe man beide Hände in den Topf mit der Wassermischung.
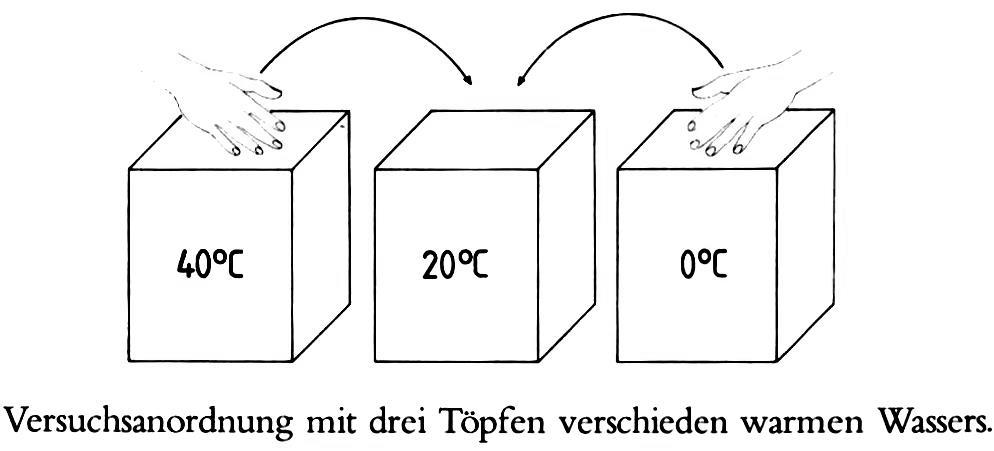
Über das Verhältnis des menschlichen Denkens zu den Sinneserfahrungen sei an dieser Stelle Goethe zitiert:
Den Sinnen hast du dann zu trauen,
Kein Falsches lassen sie dich schauen,
Wenn dein Verstand dich wach erhält.
Mit frischem Blick bemerke freudig
Und wandle, sicher wie geschmeidig,
Durch Auen reichbegabter Welt.
Wir wollen prüfen, ob uns unser Verstand bei der Urteilsbildung wach erhalten hat. Der Inhalt der Erfahrung, die wir gemacht haben, ist leicht zu beschreiben: beide Hände haben ein verschiedenes Erlebnis beim gleichzeitigen Eintauchen in den Topf mit dem Wasser mittlerer Temperatur. Die linke Hand, die aus dem Topf mit kaltem Wasser kam, empfindet warm; die rechte Hand, die aus dem Topf mit warmem Wasser kam, dagegen kalt. Lässt man die Hände einige Minuten im Wasser mittlerer Temperatur, klingt die geschilderte Wahrnehmung ab. Wollen wir jetzt sachgemäss urteilen, müssen wir sagen, dass unser Wärmesinn Temperaturdifferenzen erlebt: durch die linke Hand eine positive Differenz = wärmer, durch die rechte Hand eine negative = kälter. Leider ist es üblich, gerade dieses Experiment dazu zu benutzen, um sogenannte Sinnestäuschungen nachzuweisen. Das vorgebrachte Fehlurteil besteht darin, dass behauptet wird, im Topf mit dem Wasser mittlerer Temperatur müssten beide Hände die gleiche Empfindung haben. Dass das nicht der Fall sei, habe auch die Sinneserfahrung keinen objektiven Inhalt. Wer so urteilt, irrt sich über das Wesen der Temperaturmessung, das er der Beurteilung der Sinneserfahrung zugrundelegen will, denn er geht ja davon aus, dass zwei Thermometer, in das Wasser mittlerer Temperatur gehalten, die gleiche Temperaturhöhe anzeigen. Er vergisst, dass auch die Temperaturmessung mit Differenzen geschieht. Es gibt dabei ein Konvention, gegen welchen Temperaturwert die Differenz gemessen wird: das ist der Gefrierpunkt des Wassers. Seine beiden Thermometer messen im Wasser mittlerer Temperatur diese gegen °C, Das macht der Wärmesinn ohne Frage nicht. Er «misst» die Differenzen einmal vom heissen und zum anderen vom kalten gegen das Wasser mittlere Temperatur. Das können die Thermometer auch: man braucht sie nur ebenso wie die Hände vom kalten, beziehungsweise vom heissen Wasser her in das mittlerer Temperatur zu bringen und man wird finden, dass das eine steigt und das andere fällt. (Noch besser macht man so etwas mit dem Temperaturschreiber, bei dem dann die fallende und die steigende Temperaturkurve schwarz auf weiss zu betrachten ist.) Im Wärmesinn lebt keine Konvention über den Temperaturpunkt, gegen den zu messen ist, sondern er nimmt gegen die jeweils vorangehende Temperatur wahr wie das Thermometer, wenn man seinen Gang wirklich beobachtet. Der Wärmesinn ist also ein Sinn, der uns auf sachgemässe Weise mit den wechselnden Wärmeverhältnissen unserer Umwelt in Beziehung bringt. Alles andere offenbart sich bei sorgfältiger Prüfung als Denkschwäche.
Das ist noch nicht alles, was wir mit dem Wärmesinn wahrnehmen können. Wir kennen das Phänomen, dass wir für den Wärmezustand unseres eigenen Leibes anfangen aufzuwachen, wenn wir zu schwitzen beginnen. Dann fühlen wir uns selbst zu warm.
Umgekehrt, wenn wir ohne ausreichende Kleidung in der Kälte stehen, empfinden wir uns selbst nach einiger Zeit zu kalt, frieren und fangen an zu zittern. Schwitzen und Zittern sind deutlich von einer Temperaturempfindung des zu kalten oder zu warmen eigenen Leibes begleitet. Auch hier wird vom Wärmesinn eine Differenz wahrgenommen: die Differenz zu dem Wärmebereich, in dem sich der mitteleuropäische Mensch wohlfühlt. Und das ist ungefähr der Bereich zwischen 18°und 28°C. Innerhalb dieses Bereiches verklingt die Wahrnehmung einer Wärmedifferenz schnell. Ausserhalb dieses Bereiches bleibt sie solange wach, von den physiologischen Vorgängen des Zitterns oder Schwitzens begleitet, bis sich der Mensch wieder in einen Temperaturraum begibt, in dem er sich wohlfühlen kann. Dieses Wohlfühlen ist die seelische Antwort auf die unbewusst bleibende Wahrnehmung des Wärmesinns. Schwitzen und Zittern sind dagegen von antipathischen, dauernd wach bleibenden Empfindungen, begleitet.
Schliesslich gibt es eine dritte Art, in der der Wärmesinn tätig ist. Darauf werden wir aufmerksam, wenn wir uns daran erinnern, dass verschiedene Materialien, sagen wir Kupfer und Holz, auch bei gleicher Temperatur vom Wärmesinn verschieden erlebt werden. Fasse ich bei gleicher Temperatur der Materialien Kupfer mit der einen Hand und Holz mit der anderen an, so fühlt sich das Kupfer kalt, das Holz dagegen warm an. Der Wärmesinn sagt uns in diesem Fall etwas über das Verhältnis aus, das die Substanz selber zur Wärme hat. Das Kupfer ist für die Wärme eine durchlässigere Substanz, die sie in einem viel geringeren Masse staut als das Holz. Auch diese Wahrnehmung wird mit der Wärmestaufähigkeit des eigenen Leibes in Beziehung gebracht.
Durch das Kupfer fliesst die Wärme schneller, durch das Holz langsamer als durch die fühlenden Fingerspitzen. Das erstere wird kühl, das letztere warm empfunden.
So haben wir, wie schon beim Sehsinn, Geruchs- und Geschmackssinn, sechs Urphänomene gefunden, die zusammen das Wärmefeld der Wahrnehmung erschliessen: Einmal den Wärmezustand des eigenen Leibes, den wir ausserhalb der Temperaturgrenzen wahrnehmen, innerhalb derer wir uns wohlfühlen, polar dazu das Wärmeverhalten fremder Substanzen und vermittelnd dazwischen den Wechsel der Umgebungstemperatur.
In jedem dieser drei Phänomengebiete gibt es Paare polarer Urphänomene, die sich gegenseitig ausschliessen. Die Empfindung ist entweder wärmer oder kälter, sie kann nicht beides sein. Die Intensität der Wahrnehmung steigt mit der Differenzgrösse, die innerhalb des Beziehungsgefüges des Wärmesinnes auftritt. Damit lässt sich das Spektrum auch dieses Sinnes im Schema darstellen:
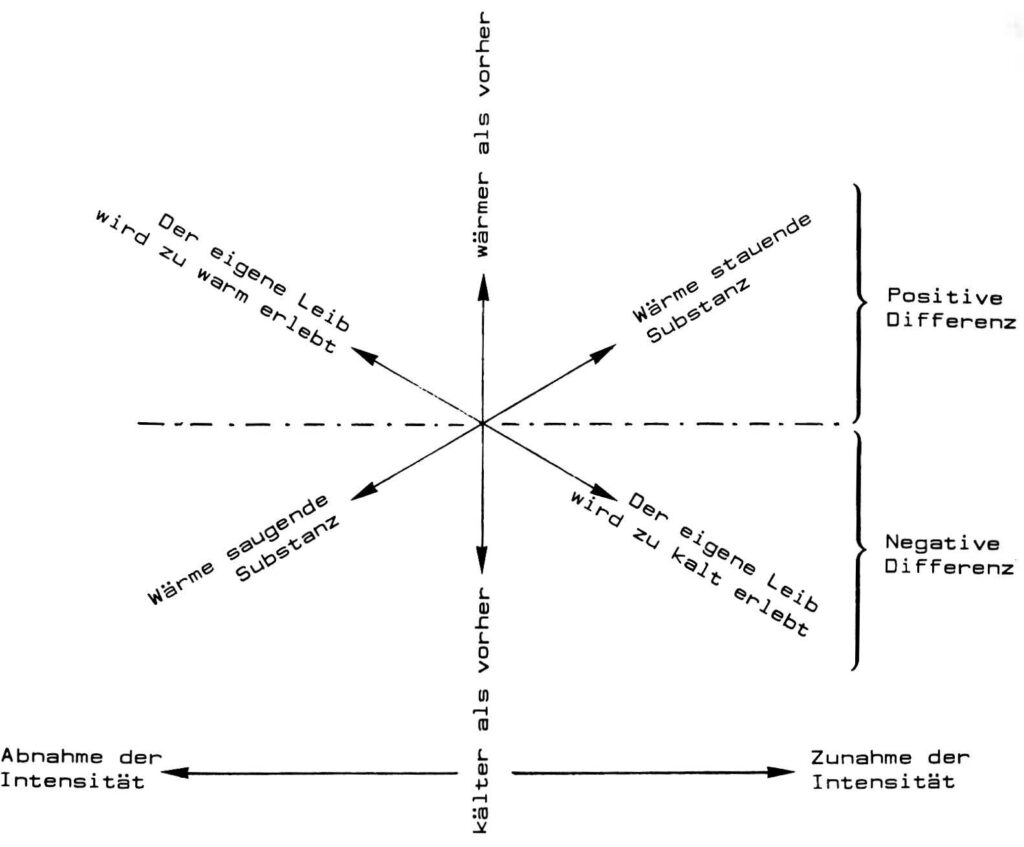
Für welche Schicht der Welt öffnet sich der Wärmesinn? Eine Antwort ist nicht so leicht zu finden wie beim Seh-, Geruchs- und Geschmackssinn. Wir müssen zunächst ins Auge fassen, dass der Mensch so etwas wie eine Wärmeorganisation hat, die einen tagesrhythmischen Phasenwechsel zeigt. Die Wärmeorganisation des Menschen ist durch zwei räumliche Gebiete charakterisiert, die ein unterschiedliches Wärmeverhalten, besonders bei Kältebelastung, zeigen: Wärmekern und WärmemanteL Der Wärmemantel umfasst das Gebiet von der Hautoberfläche bis wenige Zentimeter nach innen, und die Gliedmassen. Der Wärmekern umfasst mehr den Kopf und das Leibesinnere des Rumpfes. Bei Kältebelastung kühlt sich der Mantel ab, aber die Kerntemperatur wird gehalten. Das kann so weit gehen, dass die Durchblutung der Gliedma~sen fast vollkommen aufhört und Erfrierungen eintreten, wenn das zur Aufrechterhaltung der Kerntemperatur notwendig ist.In unserem Zusammenhang interessiert aber mehr das tagesrhythmische Verhalten von Mantel und Kern. Nachts sinkt die Kerntemperatur um einen (geringen) Betrag, tags steigt sie. Umgekehrt die Manteltemperatur. Tags sinkt sie und erhöht sich nachts im Schlafe. Dazu kommt noch eine räumliche Komponente: nachts dehnen sich Mantel und Kern aus, tags ziehen sie sich zusammen, so dass am Tage die Mantel-Kern-Grenze tiefer im Leibe liegt. Ein Grund dafür, warum wir uns nachts zudecken und dann Behagen empfinden, wenn die Bettdecke eine nicht zu geringe Dicke hat.
Den Tag-Nacht-Rhythmus bringt das Ich in die menschliche Organisation. Am Tage erleben wir uns selbst als Zentrumswesen. Von diesem Ich geht jede Intention aus, die wir in die Wahrnehmung oder in das Handeln tragen. Nachts verlässt das Ich zusammen mit der Seele den lebendigen Leib und wird schlafend zu einem Umkreiswesen. Diesen Rhythmus macht die Wärmeorganisation in gewisser Weise mit. Tags zieht sie sich wie das Ich zusammen, nachts dehnt sie sich aus, den Kern abkühlend und den Mantel erwärmend, damit dem wärmer werdenden Teil, dem Ich, im sphärischen Zustand, sich zuwendend. In der im folgenden beschriebenen Situation kann man erleben, dass das so ist: muss man nachts zu einer ungewohnten Zeit aufstehen, beispielsweise zwischen ein und vier Uhr, stellt sich bald nach dem Aufstehen ein inneres Frösteln ein. Das kommt dadurch zustande, dass die Kerntemperatur für das Zentrums-Ich des wachen Zustandes noch zu kühl ist. Umgekehrt, wenn wir einschlafen, lässt sich bei einiger Übung beobachten, dass sich im Einschlafen eine innere Wärmewahrnehmung einstellt. Das Ich verlässt bereits den Leib und die Kerntemperatur ist noch nicht gesunken.
Aus den beschriebenen Phänomenen lässt sich noch nicht urteilen, dass der Wärmesinn die geistige Schicht der Welt, dem das Ich ja angehört, den Sinnen im Abbild erschliesst. Aber wir können sagen, dass die menschliche Wärmeorganisation für die beiden Ich-Zustände offen ist und der Wärmesinn dem Menschen dann (ein meist unbewusst bleibendes) Wohlempfinden vermittelt, wenn Ich und Wärme organisation aufeinander eingestimmt sind. Wir empfinden Frösteln oder Wärme im Innern in den Umstimmungsphasen. Das Ich ist daher bestimmend für den Temperaturraum und die Temperaturzone, mit der der Wärmesinn vergleicht, wenn wir Temperaturübergänge wahrnehmen oder besonders uns selbst alszu warm oder zu kalt empfinden. Das Geistige in uns selbst scheint das Mass zu sein, mit dessen Wärmestimmung der Wärmesinn arbeitet. Das Geistige ist deshalb nicht Inhalt der Wahrnehmung, sondern Mass des Wahrnehmens. Es ist der Sinneswahrnehmung übergeordnet.
Zusammenfassung: Die Gefühlssinne
Zusammenfassung: Die Gefühlssinne
Wir haben damit gefunden, dass sich die vier bisher besprochenen Sinne nach den Schichten der Welt ordnen lassen, für deren Abbilder sie offen sind. Für den physischen Leib ist der Geruch so offen, dass er dem Menschen Kunde gibt, wie das Tote in der Gesamtorganisation wirkt. Für die Lebensorganisation (Ätherleib) ist der Geschmack so offen, dass er dem Menschen Kunde gibt, wie die kosmischen und irdischen Wirkungen im Lebendigen schaffend tätig sind. Für die seelische Welt ist der Sehsinn so offen, dass er die sich weitende Seele mit den Farben verbindet oder die sich zusammenziehende Seele davon distanziert. Für die geistige Schicht der Welt ist der Wärmesinn so offen, dass der Rhythmus des Ich zum Mass der Wahrnehmung wird.
Die gleiche Ordnung finden wir auch, wenn wir untersuchen, wie die einzelnen Phänomene der vier Sinnesspektren untereinander zu beurteilen sind. Beim Geruch stehen, um ein Beispiel zu nennen, «duftend-blumig» und «stinkend-faulig» so nebeneinander, dass man sich erst auf die Ganzheit des Spektrums besinnen muss, um darauf aufmerksam zu werden, dass es sich hier um Polaritäten handelt. Auch sind beide Gerüche mischbar, ohne dass sie sich in irgend einer Weise gegenseitig auslöschen. Das gegenseitige Auslöschen beginnt beim Geschmack, insofern sich polare Geschmacksqualitäten gegenseitig mildern, und erreicht einen Höhepunkt bei den Farben, die sich zum vollkommenen Grau mischen. Beim Wärmesinn schliessen sich die Polaritäten von vornherein gegenseitig aus. Entweder empfinde ich mich selbst als zu kalt oder als zu warm. Die Empfindung ist immer eine absolute.
Die besprochenen vier Sinne lassen sich also in eine Reihe ordnen:
Wärmesinn, Mittler der geistigen Welt
Geruch, Mittler der physischen Welt
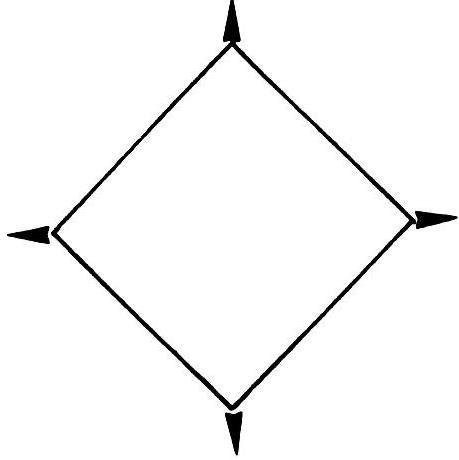
Sehsinn, Mittler der seelischen Welt
Geschmack, Mittler der lebendigen Welt
Die Willenssinne
Der Tastsinn
Der Tastsinn
Die leiblichen Werkzeuge, die dem Sehsinn, dem Geschmack und dem Geruch dienen, sind lokalisierte Gebiete des physischen Leibes – zwar unterschiedlicher morphologischer Gestalt, aber gut beschreibbar. Dem Wärmesinn dagegen dient die gesamte Oberfläche des Leibes, die Haut ist sein Werkzeug. Auch hier finden sich morphologische Differenzierungen, durch die sich die Haut mehr oder weniger gut als Werkzeug für die Tätigkeit des Wärmesinnes eignet. Es scheint so, dass alle konkaven Stellen der Haut deutlich empfindlicher sind als die konvexen Flächen. Die Mutter prüft die Wärme der Milchflasche am Auge. Man prüfe selbst die Empfindlichkeit unter der Achsel oder in der Leistenbeuge. Auch die Zunge, das Riechorgan und selbst die Augen liegen in Körperhöhlen – offenbar eine Gemeinsamkeit von Organen der bisher besprochenen Sinne.
Beim Tasten ist es anders. Beginnen wir mit konkaven Flächen, beispielsweise dem Handteller, der sich für die Wärmewahrnehmung gut eignet. Wenn wir mit der ganzen Handfläche gegen eine Tischplatte tasten, zeigt sich sofort die Untauglichkeit dieser Körperstelle. Anders dagegen verhält es sich bei den Fingerspitzen. Mit ihnen haben wir deutlichere Tasterlebnisse. Probieren wir weiter, zeigt sich, dass der Fingernagel ein noch geeigneteres Organ ist als die Fingerkuppe. Eine weitere Steigerung erfährt das Tasterlebnis, wenn wir einen spitzen Gegenstand zu Hilfe nehmen, zum Beispiel einen Bleistift. Auch das Organ des Tastsinnes ist über die ganze Oberfläche des Leibes verteilt, aber die Deutlichkeit der Wahrnehmung steigt, je spitzer und härter das vorgewölbte Tastorgan ist. Tastet man mit einem spitzen Bleistift oder einem ähnlichen Instrument über verschiedene Gegenstände, wird die Rauheit viel deutlicher erlebt, als es mit der Fingerkuppe möglich wäre. Auf diese Weise fortexperimentierend zeigt sich bald, dass man zum Ertasten der verschiedenen Oberflächen das jeweils geeignete Tastinstrument erst finden muss. Um feine Kratzer auf einer Glasplatte zu tasten, eignet sich eine Nadel, die am besten in einem Griff, zum Beispiel einem dünnen Pinselstiel, gefasst ist. Dagegen ist die Nadel ganz ungeeignet, die Rauheit von Papier oder Stoff wahrzunehmen. Hier hilft uns die rundgeschliffene Spitze eines Drahtes von der Stärke der Büroklammern. Besinnt man sich beim Tasten mit einem spitzen Bleistift über eine Holzoberfläche, ob es ausser der Wahrnehmung «rauh» an der Spitze des Bleistiftes ein weiteres Erlebnis gibt, können wir wach werden dafür, dass auch die haltenden Fingerspitzen ein Tasterlebnis haben, das wir sonst verschlafen. Richten wir unsere Aufmerksamkeit auf diese Erfahrung, können wir sie mit dem Wort «hart» beschreiben. Von jetzt an hängt es von unserer Intention ab, wohin wir die Aufmerksamkeit richten, ob wir «rauh» an der betasteten Oberfläche oder «hart» an den Fingerspitzen wahrnehmen. Die Frage dieser willkürlich zu richtenden Aufmerksamkeit wird uns später noch ausführlich zu beschäftigen haben. Hier soll uns diese Erfahrung darauf hinweisen, dass wir bis tief in den Leib hinein – und nicht nur mit künstlichen Werkzeugen wie in dem beschriebenen Experiment – träumend bis schlafend überall dort Tasterfahrungen machen, wo sich feste bis harte Oberflächen begegnen: so in allen Gelenken. Im beschriebenen Experiment können wir unsere Aufmerksamkeit nicht nur auf Bleistiftspitze oder Fingerkuppe, sondern auch auf die Gelenke der Finger, der Hand, bis in das Gelenk des Ellenbogens richten und das jeweilige Tasterlebnis beschreiben.
Im Gegensatz zu der Gruppe der früher besprochenen Sinne bleibt die Tasterfahrung nicht in der Umwelt des Menschen, sondern sie reicht von der Oberfläche des Tastorgans, auch des technisch erweiterten, bis tief in das Skelett hinein.
Zwei Tasterfahrungen, «rauh» und «hart», haben wir schon bezeichnet. Eine erste Polarität von Tasterfahrungen lässt sich feststellen, wie eben beschrieben, wenn wir mit einem geeigneten Tastinstrument über eine Oberfläche tasten. Die Pole dieser Erfahrung kann man «glatt» und «rauh» nennen und dazwischen kontinuierliche Übergänge finden.
Eine zweite Polarität von Tasterlebnissen entdecken wir, wenn wir das Tastinstrument gegen, und nicht über eine Oberfläche führen. Beginnen wir mit der Fingerkuppe. Vorsichtig gegen eine Tischoberfläche getastet, erleben wir erst einmal «weich». Mit der Verstärkung des Druckes geht «weich» in demselben Masse in «hart» über, wie der Druck verstärkt wird. Macht man dasselbe Experiment mit einer Bleistiftspitze, so erlebt man von vornherein «hart». Das «Weich»-Erlebnis rührt von einer Wahrnehmung unserer Fingerspitzenmuskulatur her und geht erst nach und nach über in das Erlebnis des Verhältnisses zwischen dem dahinterliegenden Knochen und der Tischplatte. Dieses erst erzeugt die Wahrnehmung «hart». Auch hier ist es wichtig, das geeignete Tastinstrument jeweils zu finden, wenn wir die Härte oder Weichheit einer Oberfläche tastend erleben wollen.
Mit den zwei Richtungen des Tastens haben wir Verhältnisse beobachtet, bei denen das Tastinstrument deutlich kleiner war als das Tastobjekt. Lässt sich dieses Verhältnis auch umkehren? Tasten wir also mit der Fingerkuppe gegen ein Tastobjekt, das kleiner als diese ist, beispielsweise sowohl gegen die Spitze als auch gegen das Ende eines Bleistiftes. Der erste Erfahrungsinhalt kann mit «spitz», der zweite mit «rundlich» bezeichnet werden. (Das Wort «stumpf» muss aufgespart werden für einen anderen Erfahrungsinhalt.) «Rundlich» bezeichnet, auch wenn es ungewohnt klingt, zutreffend den tatsächlichen Inhalt der Erfahrung. Man prüfe das an mehreren Objekten, deren Tastfläche rund, eckig oder gar ringförmig sein kann. Wenn die (kleine) Tastfläche eine bestimmte Grösse nicht überschreitet, bleibt das Erlebnis von ihrer Form unabhängig, eben «rundlich». Wollen wir über ein Tastobjekt streichen, das kleiner als das Tastorgan ist, muss es eine gewisse Länge haben, wie zum Beispiel eine Messerklinge. Hier kann die Erfahrung einmal «scharf» und ein andermal «stumpf» sein. Wieder haben wir zwei Paare von Polaritäten mit allen Übergängen dazwischen gefunden.
Ein letztes Polaritätenpaar lässt sich entdecken, wenn das Tastinstrument in das Objekt eindringt. Das ist bei Wasser bis hin zum Teer der Fall. Die Erfahrung reicht dann von «flüssig» bis «zäh». Hat nur die Oberfläche eine durchdringliche Konsistenz, können wir beim Darübertasten «glitschig» bis «klebrig» erleben.
Diese 12 Urphänomene sind der Reigen des ganzen Tastfeldes. Sein Spektrum setzt sich aus drei Doppelpolaritäten zusammen, die auf die folgende Art beschrieben und in ein Schema gebracht werden können:
Das Tastobjekt ist von undurchdringlicher Konsistenz
– es ist grösser als das Tastinstrument:
- dagegengetastet ergibt „hart“ bis „weich“
- darübergetastet ergibt „glatt“ bis „rauh“
Das Tastobjekt ist von undurchdringlicher Konsistenz
– es ist kleiner als das Tastinstrument:
- dagegengetastet ergibt „spitz“ bis „rundlich“
- darübergetastet ergibt „scharf“ bis „stumpf“
Das Tastobjekt ist von durchdringlicher Konsistenz:
- dagegengetastet ergibt „flüssig“ bis „zäh“
- darübergetastet ergibt „glitschig“ bis „klebrig“
Ohne den Raum, den die Gegenstände erfüllen, hätte der Tastsinn keine Objekte. Ohne ihr Beharrungsvermögen und ohne ihre Masse würde er sie nicht in die Erfahrung bringen. Die Schwerkraft schliesslich ist es, die als eine dauernde Wirkung die Knochen des Skelettes gegeneinander und den ganzen Leib gegen seine Stand fläche zieht. Für die davon ausgehenden Wahrnehmungen werden wir – ohne besondere Intention – um so wacher, je älter wir werden. Es ist die physische Welt, in die uns der Tastsinn stellt. Er führt uns in die tote Welt schwerer Massen.
Der Lebenssinn
Der Lebenssinn
Mit dem Lebenssinn verfügen wir über ein Sinnesfeld, das uns die Lebenszustände des eigenen Leibes erschliesst. Ein einfaches Experiment bringt eine erste Erfahrung. Man schwinge einen Arm aus lose hängender Haltung in die Horizontale auf, halte ihn in dieser Lage und beobachte, wie sich die Wahrnehmung im Arm mehr oder weniger schnell ändert. Beschreiben wir diese Erfahrung: noch im Aufschwingen in die Horizontale habe ich eine Wahrnehmung der Leichte, die mit der Zeit in Schwere und schliesslich in Schmerz übergeht, wenn die Last nicht mehr zu tragen ist. Dieses Gefühl von Leichte oder Schwere ist etwas, was man besonders aus den Gliedmassen während der körperlichen Arbeit kennt. Wer längere Zeit schwere Schuhe oder auch einen schweren Rucksack getragen hat, wird das Gefühl der Leichte kennen, wenn er sich der Last entledigt. Hier wandelt sich Schwereempfindung in Empfindung der Leichte – umgekehrt im Vergleich mit dem obigen Experiment. Immer aber klingen die Wahrnehmungen nach kurzer Zeit ab, ebenso schnell wie sie sich entwickeln. Sie haben einen kurzen Rhythmus. Polar dazu, aber nicht so wach zu erleben, ist das Gefühl, das man vom Ganzen seines Leibes hat, wenn man morgens nach einer guten Nacht vom Frühstückstisch aufsteht, oder die Empfindung, die man nach einem arbeitsreichen Tag hat, wenn man abends ins Bett sinkt. Die Morgenfrische, wie wir die erste der beiden Wahrnehmungen nennen wollen, ist etwas, was man aus seiner Jugendzeit bis in die zwanziger Jahre als etwas kennt, das einen ständig erfüllte. Die Abendmüdigkeit nimmt mit dem Alter so zu, wie die Morgenfrische abnimmt. Im ganzen ist es aber doch ein Tagesrhythmus, auf dessen Verwandlung im Lebensgang wir eben geblickt haben.
Zwischen den beiden Polaritäten, der einen mit dem kurzen und der anderen mit dem langen Rhythmus des Tages, findet sich eine dritte Wahrnehmungspolarität. Hat man – besonders wenn man es nicht gewohnt ist – einige Stunden körperlich gearbeitet, stellt sich das Gefühl der «Abgeschlagenheit» oder Mattigkeit ein, wie man es als Dauerzustand auch von manchen Krankheiten kennt. Polar dazu ist der Zustand, in dem man nach einer erholsamen Pause – besonders wenn man in der Arbeit, die gemacht wird, geübt ist – die kraftvolle Frische wieder spürt, die einen in die Hände spucken lässt. Das ist ein Stundenrhythmus.Auf die Lebenszustände des eigenen Leibes blickend, können wir sechs Urphänomene in drei nach ihrem Rhythmus geordneten Polaritäten finden:
Morgenfrische – Abendmüdigkeit
Kraftgefühl – Abgeschlagenheit
Leichte – Schwere.
Eine zweite Gruppe von Empfindungen des Lebenssinnes finden wir in den Verhältnissen, die die eigene Lebensorganisation zur Umwelt eingeht. Man halte einige Zeit die Luft an und beobachte die einsetzende Empfindung, die wir als Atemnot beschreiben können. Für die gegensätzliche Empfindung, die wir in frischer Bergluft, aber auch nach einigen tüchtigen Atemzügen haben, kennt unsere Sprache keine eindeutig zutreffende Bezeichnung. Es soll «atemkräftig» dafür vorgeschlagen werden. In der Wahrnehmung von Atemkraft und Atemnot haben wir hier die Polarität mit dem kürzesten Rhythmus gefunden.
Ein zweiter Rhythmus hängt mit der Aufnahme von Flüssigkeit zusammen. Auch hier ist es schwierig, zum Durst, der die Empfindung des Mangels beschreibt, das seinen Gegensatz bezeichnende Wort zu finden. In dem schönen Partizip «erquickt» lebt mehr die seelische Antwort auf die Wahrnehmung als diese selbst. Wir wollen es trotzdem aufnehmen und dabei beachten, dass wir es allein für die Bezeichnung des Wahrnehmungsinhaltes verwenden wollen.
Die dritte Polarität, die sich auf die feste Nahrung bezieht, ist mit den Worten «satt» und «hungrig» gut beschrieben. Da wir mehrmals täglich essen und trinken, ist es schwer zu sagen, welcher der beiden Rhythmen «erquickt – durstig» oder «hungrig – satt» die längere Phase hat. Das stellt sich erst heraus, wenn man erfährt, welche der beiden Mangelsituationen der Organismus länger erträgt: zweifellos den Hunger. Deshalb stellen wir die drei Polaritäten der umweltgerichteten Seite der Lebensorganisation in die folgende Reihe, die sich aus der abnehmenden Phasenlänge ihrer Rhythmen ergibt: satt – hungrig, Erquickung – Durst, Atemkraft – Atemnot.
Es ist naheliegend, die 12 Urphänomene des Spektrums des Lebenssinnes im Kreis zu ordnen und die drei Phasenlängen ihrer Rhythmen als Ordnungsprinzip heranzuziehen:
Kurzer Rhythmus der Lebensorganisation
- umweltgerichtete Seite: Atemkraft – Atemnot
- leibgerichtete Seite: Leichte – Schwere.
Mittlerer Rhythmus der Lebensorganisation
- umweltgerichtete Seite: Erquickung – Durst
- leibgerichtete Seite: Kraftgefühl – „Abgeschlagenheit“.
Langer Rhythmus der Lebensorganisation
- umweltgerichtete Seite: satt – hungrig
- leibgerichtete Seite: MorgenFrische – Abendmüdigkeit.
In der Regel ist der Mensch für diesen Sinn nicht besonders wach. Wer gesund ist, sein Leben harmonisch gestaltet, bei dem erscheint die Wahrnehmung des Lebenssinnes nur, wenn er seine Aufmerksamkeit bewusst auf einzelne Phänomene richtet. Sonst aber stellt sich ein seelisches Gefühl gegenüber dem Leibe ein, das man «behaglich» nennen kann. Es ist die die Leibesempfindung begleitende Stimmung der Seele, die sofort unterbrochen wird, wenn die Wahrnehmung eines einzelnen Phänomens hervortritt. Wie wir im Fortgang der Betrachtung noch sehen werden, wie einleitend und wie eben noch einmal kurz erwähnt, zeigt die menschliche Lebensorganisation (Ätherleib) zwei Wirkungsrichtungen: zur Umwelt gerichtet zerstört sie alle qualitativen Eigenschaften, die der Mensch aufnimmt, soweit, dass davon kein Rest mehr bleibt. Die auf den eigenen Leib gerichtete Seite erhält diesen, lässt ihn wachsen und reproduziert ihn. Von den Tätigkeiten unseres Ätherleibes in unserem physischen Leib gibt uns der Lebenssinn Kunde.
Wie verhält es sich mit dem Schmerz? Man könnte denken, dass er ein Phänomen des Lebenssinnes sei, zumal wir ihn hier schon erwähnt haben. Als wir die Erfahrung des schwerwerdenden Armes gemacht haben, ist die Wahrnehmung der Schwere langsam in die des Schmerzes übergegangen. So ist es auch beim Tastsinn. Wenn wir eine Spitze tasten, brauchen wir nur den Druck zu verstärken, und die Wahrnehmung geht in Schmerz über. Beim Wärmesinn ist es nicht anders, wenn wir uns einer heissen Platte nähern. Schmerz ist eine Empfindung, die sich immer dann einstellt, wenn ein beliebiges Phänomen der Wahrnehmungswelt über eine bestimmte Schwelle hinaus gesteigert wird. Schmerz ist im Gegensatz zur Sinnesempfindung indifferent. Es ist immer derselbe Schmerz, ob er aus dem Wärme-, dem Tast-, dem Lebenssinn oder irgend einem anderen Sinn hervorgeht. Trotzdem bleibt der Eindruck berechtigterweise bestehen, dass der Schmerz auch im Leibe, und nicht nur in der Seele ist, wo er selbstverständlich auch entstehen kann. Worum es sich handelt, wird man am besten an lokalisierten Sinnesorganen wahrnehmen können, an Auge und Ohr. Geht die Licht- oder die Tonwahrnehmung durch Steigerung in Schmerz über, so entsteht dieser im Sinnesorgan. Das Auge oder das Ohr schmerzt. Statt ein Tor zur Welt für die Seele zu sein, erscheint das Organ selbst im Sinnesbewusstsein. Damit hängt zusammen, dass der Schmerz räumlich differenziert sein kann. Er kann an der Oberfläche des Leibes auftreten oder im Inneren. Er kann punktuell oder flächig erscheinen. Auch sein zeitlicher Ablauf und seine Intensität differenzieren sich. Da der ganze Leib an jeder Stelle schmerzen kann (von Haaren, Nägeln und dem Zahnschmelz abgesehen), ist auch der ganze räumliche Leib des Menschen Sinnesorgan.
Der Bewegungs- und Lagesinn
Der Bewegungs- und Lagesinn
Beginnen wir wiederum mit einem Selbstversuch. Man schliesse die Augen, bewege eine Hand und beobachte, welche Bewegung der ausgestreckte Zeigefinger dabei im Raum ausführt. Unterscheidend lassen sich dabei zwei Qualitäten feststellen. Ob die Bewegung schnell oder langsam oder ob sie gerade oder gekrümmt geführt wird. Wollen wir «schnell» oder «langsam» von «gerade» oder «gekrümmt» isolieren, bleibt nur übrig, einen Punkt vorzustellen und allein dessen Verhalten in der Zeit, nicht im Raume, zu beobachten. Das ist zwar etwas, was in der Sinneswirklichkeit als reine Beobachtung nur annähernd zu erleben ist, aber als Qualität natürlich vom linearen Aspekt von «gerade – krumm» getrennt werden muss. Das Zeitliche einer Bewegung kann aber auch ganz zur Ruhe kommen. In diesem Fall bleibt eine Wahrnehmung von der Lage meines Fingers im Verhältnis zu mir selbst bestehen. Diese Wahrnehmung kann ich von allen meinen Gliedern haben: am deutlichsten von allen Vorsprüngen, besonders den Gliedrnassen, am wachsten an den Händen. Da der Bewegungssinn auch eine Wahrnehmung des ruhenden Leibes vermittelt, können wir ihn auch Lagesinn nennen. Denn die Lage der Glieder zueinander ist für diesen Sinn der Inhalt ihrer Wahrnehmung, wenn sie ruhen. Will ich für die Qualitäten der Lage meiner eigenen Leiblichkeit «zu mir selbst» erwachen und das nicht als eine Frage der euklidischen Geometrie abtun, ist es gut, mir ein Empfindungsurteil darüber zu verschaffen, welche der zu erlebenden Polaritäten der Raumrichtungen «vorn – hinten», «links – rechts» und «kopfwärts – fusswärts» mit den bisher entdeckten polaren Bewegungsqualitäten: «ruhend – schnell» und «krumm – gerade» zusammenklingen. Die zeitliche Komponente von «ruhend – schnell» passt nur zu der Raumrichtung «hinten – vorn». In der Art, wie ich mich gehend fortbewege, wie ich durch die Welt oder den Raum schreite, drückt sich meine eigene seelische Natur aus: vom tastend-zögernden bis zum kraftvoll-zielsicheren Schritt vorwärts. Gemeint ist damit nicht die Art, wie der Mensch als Ich-Wesen seinen Schritt führen kann. Da ist er frei zum Gestalten dessen, was der Situation angemessen ist. Gemeint ist dasjenige, was sich unbewusst im Schreiten eines Menschen seelisch ausdrückt.
Der Raum, der mich in ein linkes und in ein rechtes Wesen teilt, ist der Raum, in dem Arme und Hände ihr Bewegungsspiel entfalten. Da kommt es auch auf den Gegensatz «ruhend – schnell» an, aber die zweite Polarität «gerade – krumm» tritt dazu. Im schnellen Deuten bis zum langsam beschreibenden Bogen lebt die Gestik, in der sich das menschliche Seelenwesen rein ausspricht.
Bleibt noch «kopfwärts – fusswärts». Lässt sich auch zu dieser Lagewahrnehmung eine Bewegungspolarität entdecken, die so zu ihr passt wie «ruhend – schnell» zur Lage «hinten – vorn» und «gerade – krumm» zu «links – rechts»? Bauen wir dazu eine Reihe auf Die Polarität «ruhend – schnell» lebt sich vor allem in der Zeit dar, für das zugehörige Räumliche genügt ein Punkt. Aus dem Punkt wird eine Linie, wenn die Polarität «gerade – krumm» dazukommt. Wir sehen also, dass wir einen Schritt «räumlicher» werden müssen, falls sich die Reihe fortsetzen lässt. Beobachten wir, wie Kumuluswolken, die sich am Nachmittag eines sonnigen Hochsommertages bilden, sich zu hohen, oft Gewitter ankündigenden Wolkentürmen aufbauen. In der oberen Partie solcher Wolken sieht man eine oft sehr schnell ablaufende Bewegung, die am besten mit dem Wort «quellen» belegt wird. Solche Quellbewegungen sind auch im Wasser schön zu beobachten, sei es in aufschäumenden Gebirgsbächen oder, sehr viel ruhiger und das Phänomen in Reinheit endlos und nur leicht rhythmisiert vorführend, in den Karstquellen. Am schönsten zeigt sie wohl der Blautopf in der Schwäbischen Alb. Die Polarität zur Quellbewegung nennen wir «schwinden». Auch das ist im Wasser an jedem einsaugenden Wirbel schön zu sehen. Die Natur führt vor, dass Quell- und Schwindebewegungen in der «oben – unten» oder, hinsichtlich des Menschen in der «kopfwärts – fusswärts»-Raumrichtung zu Hause sind. Wie ist es nun für das Selbsterlebnis mit quellend – schwindenden Bewegungen? Auch hier lässt sich von einer Reihe ausgehen. «Ruhend – schnell» haben wir ja das Schreiten zugeordnet empfunden, «krumm – gerade» die Arm- und Handbewegungen im freien Raum des linken und rechten Menschen, in dem sich die Seele in den Gesten offenbart. Das Quellen – Schwinden in den «kopfwärts – fusswärts»-Richtungen ist bekannt als seelisches Selbstgefühl. Damit verlassen wir die Sinneswahrnehmung.
Um ein Beispiel zu nennen: im vierten Lebensjahrsiebt hat der Mensch dieses seelische, nach oben aufquellende Erlebnis, wenn er von der sozialen Umwelt, auf die er Wert legt, in seiner Leistung anerkannt wird; im umgekehrten Fall hat er das Erlebnis des Schwindens.
Wir sehen, wie im Menschen die Bewegung aus der Sinneswelt in die Seelenwelt übergeht. Im Hinblick auf die Bewegungen in der Natur können wir sagen: in den Strömungen von Wasser und Wolken sind die quellend – schwindenden Bewegungen deutlich nicht auf den Beobachter, sondern auf das Objekt der Beobachtung bezogen. So ist es auch, wenn der Lauf eines Tieres oder der Flug eines Vogels beobachtet wird. Anders ist es mit den Raumesrichtungen der Lage. Im Seh- und im Hörfeld bezieht sich die Lage eines Ortes im Raum immer auf den Ort, von dem aus beobachtet wird. «Vorn – hinten», «links – rechts», «kopfwärts – fusswärts» breiten sich vom Beobachtungsort in die Umwelt aus. Deshalb sind Lagewahrnehmungen mehr dem eigenen Leib, Bewegungswahrnehmungen mehr dem Umgebungsraum zugeordnet.
Aus den entwickelten Gesichtspunkten lassen sich damit die 12 Urphänomene des Lage- und Bewegungssinnes zum Spektrum ordnen:Zeitliche Komponente herrscht vor:
- Umraum: schnell – ruhend
- Eigenraum: vorn – hinten
Zeitlich-räumliches Gleichgewicht:
- Umraum: gerade – krumm
- Eigenraum: links – rechts
Räumliche Komponente herrscht vor:
- Umraum: quellen – schwinden
- Eigenraum: kopfwärts – fusswärts
Auf die Schicht der Welt, die sich dem Menschen durch den Lage- und Bewegungssinn offenbart, haben wir schon hingewiesen. Alles Seelische lebt in den Bewegungen. Die Tiere sind überhaupt das Beobachtungsfeld für den Bewegungssinn. Alles Tierverhalten setzt sich aus Bewegungsabläufen zusammen. Jede Tierart zeigt das ihr eigentümliche Verhalten, von den nervösen, immer in Flucht übergehenden schnellen Bewegungen der Maus bis zu den ruhigen, durch die Umwelt nur wenig beeinflussten Verhaltensweisen der Rinder. Schad hat gezeigt, dass Färbungen und Verhalten der Tiere korrelierende Erscheinungen sind. Aus unserem Gesichtspunkt hängen Farben und Bewegungen ebenfalls zusammen, da beide in der Seelenwelt ihren Ursprung haben. Der Bewegungssinn kann in seiner Bedeutung für die Ganzheit des Sinneserlebnisses nur dann richtig eingeschätzt werden, wenn wir noch auf einige Phänomene aufmerksam machen.
Nicht nur die menschliche Gestalt als Ganzes dient dem Lage- und Bewegungssinn als Sinnesorgan, wie es der Fall ist, wenn ich die Lage eines meiner Organe zum Ganzen des Leibes wahrnehme. Der Bewegungssinn kann auch über das Auge, über das Ohr, ja sogar über den Tastsinn arbeiten. Über letzteren beispielsweise nehmen wir Bewegung wahr, wenn ein Marienkäfer oder -noch kontinuierlicher – eine Schnecke über die Hand läuft. In beiden Fällen sind zwei Sinnesqualitäten in ihrem Zusammenspiel gegeben: zum einen das Tasterlebnis, zum anderen die Bewegung über die Hand. Nur das letztere vermittelt der Bewegungssinn. Ganz unabhängig von unserem eigenen Leib erleben wir Bewegungen, die wir sehen oder hören, wenn der Bewegungssinn sich des Auges oder des Ohres als Sinnesorgan bedient. Wir sehen oder hören den Menschen oder das Tier,
das sich in der Landschaft bewegt, die Wolken, die über den Himmel ziehen, das Fliessen des Wassers oder die Bewegung der Blätter im Winde. Bleibt das sich bewegende Objekt stehen, so ist auch dann seine Lage im Verhältnis zur Lage aller anderen Dinge im Sehfeld eine Erfahrung, die wir dem Bewegungs- und hier dem Lagesinn zuzuschreiben haben.
Vor einem weiteren Problem stehen wir, wenn wir auf den Mond blicken, der sich zwischen Wolken hin und wieder blicken lässt. Hat man dabei weder eine Hauswand, einen Baum noch die Horizontlinie im Blickfeld, so wird der Mond bewegt und die Wolken werden ruhend erscheinen. Oder man sitzt im Zug und hat die Empfindung, dass die Fahrt begonnen habe, bis man bemerkt, dass es der Zug auf dem Nachbargleis ist, der sich wirklich bewegt. Das macht uns auf die Bedingungen aufmerksam, die zur eindeutigen Wahrnehmung einer Bewegung gegeben sein müssen. Es muss ein ruhendes Bezugssystem vorhanden sein. Dieses kann entweder durch die Lagewahrnehmung des ganzen Leibes oder auch durch den Hintergrund, die Kulisse des Sehfeldes, erzeugt werden. Gerade hier gilt, dass die Objekte umso eindeutiger bewegt erscheinen, je kleiner sie sind und je erfüllter die ganze Kulisse ist. Das ist eine tiefgehende Erfahrung, an die der Bewegungssinn und die in ihm waltende Intelligenz gewöhnt sind und an der sie sich geübt haben. Kehrt sich dieses Verhältnis um, wie beim Mond zwischen den Wolken, wo ja allein der Mond der Kulisse angehört, so greift der Bewegungssinn dann in der oben geschilderten Art ein. Sobald eine Hauswand oder auch nur ein Mast mit dem Mond zur ruhenden Kulisse zusammenwächst, bewegen sich die Wolken, und der Mond erscheint ruhend. Genauso ist es auch beim anfahrenden Zug. Sobald ein Kulissenelement wahrgenommen wird, das Dach des Bahnhofes, der Würstchenverkäufer zwischen zwei Wagen oder der Hintergrund des Bahnhofsgebäudes, organisiert der Bewegungssinn das Gesamtbild wirklichkeitsgemäss. Schliesslich sei noch auf eine Erfahrung hingewiesen, wo der Inhalt der Wahrnehmung davon abhängt, ob ich selber ruhe oder mich bewege. Man blicke auf einen möglichst gut übersehbaren Horizont, zum Beispiel von einem Schiff auf das Meer. Solange man mit ruhendem Blick den Horizont betrachtet, erscheint er als Gerade. Sobald man sich um seine eigene Achse dreht, erscheint er als Kreis oder Kreisabschnitt, also gekrümmt. Das leitet zu dem Problem über, dass ich im Laufen mich selbst als bewegt empfinde und die Welt als ruhend wahrnehme. Wir sind zwar sehr gewohnt, dass es so ist, trotzdem ist es nicht selbstverständlich. Man erinnere sich nur daran, dass es auf der Kinoleinwand oder auf dem Bildschirm anders ist: jeder Kameraschwenk erzeugt eine Bewegung des Bildes vor dem Betrachter. Je näher die Objekte vor der Kamera gefilmt werden, umso deutlicher bewegen sie sich durch jeden Schwenk. Im Hinblick auf den Horizont kann der zugrunde liegende Sachverhalt weit weniger deutlich bewusst werden. Man kann aber durch einen «Schwenk» auch die mit den Augen gesehenen Bilder bewegen. Dazu halte man mit der linken Hand das linke Auge zu, blicke mit dem rechten geradeaus und drücke mit dem Zeigefinger der rechten Hand von rechts unten nach links oben gegen das rechte Auge. Das gesehene Bild bewegt sich gegen die durch den Druck erzeugte Augenbewegung. Daraus ergibt sich, dass das ruhende Sehfeld nur dadurch zustande kommt, dass der Bewegungssinn die Bewegungen der beteiligten Muskulatur wahrnimmt, wenn der Blick wandert. Das liegt dem Erlebnis der Eigenbewegung vor einer ruhenden Kulisse zugrunde – unabhängig davon, ob die Eigenbewegung nur an der Augenmuskulatur oder an dem ganzen Bewegungsapparat wahrgenommen wird. Wird das Auge mechanisch von aussen bewegt, wie in unserem Experiment, fällt die Wahrnehmung der Eigenbewegung fort, und die Folge ist das wackelnde Sehfeld. Ähnlich ist es auch mit der Horizontwahrnehmung, von der wir ausgegangen sind. Ruht der Blick auf dem Horizont, erscheint er als das, was er im Ausschnitt ist: eine Gerade (man kann das mit Hilfe eines Lineals prüfen). Bringe ich mich als mich bewegender Mensch mit dem Bewegungssinn in eine Beziehung zu ihm, erscheint er als das, was er auch ist: eine in sich selbst zurücklaufende Gerade, also ein Kreis. Da die Horizontlinie wirklich beides ist, lässt es sich auch getrennt wahrnehmen.
Der Gleichgewichtssinn
Der Gleichgewichtssinn
Während wir uns als wache Menschen den Tätigkeiten des Tageslaufes zuwenden, gebrauchen wir dabei den Gleichgewichtssinn pausenlos. Für ihn selbst sind wir dabei selten wirklich wach. Das ändert sich aber schnell, wenn wir folgendes Experiment durchführen: man stelle sich aufrecht hin, die Füsse etwas auseinander, ohne die Fersen vollständig zu schliessen. Nun neige man sich im Fussgelenk rückwärts, ohne die Streckung des Körpers zu verändern. Bald ist der Augenblick eindeutig zu erleben, da die Möglichkeit, sich stehend zu halten, verlorengeht und in das Umfallen-Müssen übergeht. Je langsamer man sich neigt, umso deutlicher wird dieser Moment zu erleben sein. Gleichzeitig haben wir ein Bein zurückgestellt, um nicht wirklich umzufallen. Die Gliedrnassenbewegung, unser Gleichgewichts- und unser Bewegungssinn spielten also eng und koordiniert zusammen. Dieses Zusammenspiel soll zunächst betrachtet werden, um eine notwendige Unterscheidung treffen zu können.
Die Frage, ob bei dem eben beschriebenen Versuch auch die Wahrnehmung der Lage, also des räumlichen Verhältnisses der einzelnen Körperteile zueinander, sich verändert habe, müssen wir verneinen. (Dabei wird davon abgesehen, dass wir den Fuss zurückgestellt haben, was selbstverständlich als Lageveränderung empfunden wird.) Die Lage der Glieder in den Raumrichtungen «kopfwärts» – fusswärts», «links – rechts» und «vorn – hinten» ist während des Versuches so geblieben, wie sie vorher war. Was sich aber verändert hat, ist das Verhältnis dieser Lagewahrnehmung zur Senkrechten, sowohl zur «kopfwärts – fusswärts»- wie zur «vorn – hinten»-Empfindung. Das Zusammenspiel der «Aufrecht»- oder «Senkrecht»- Wahrnehmung des Gleichgewichtssinnes und dem den Leib ergreifenden Willen ist die Tagessituation körperlich arbeitender Menschen. Wiederholen wir nun den beschriebenen Versuch, aber mit der Absicht, für die «Auf-recht»- Wahrnehmung wirklich wach bleiben zu wollen. Dafür genügt es, nicht ganz bis an den Punkt heranzugehen, hinter dem ich das Gleichgewicht verliere. Nun wird erlebt, wie die Senkrechte vor meinem Kopf und hinter meinen Füssen liegt, wenn ich zurückgebeugt stehe. Wie sie in meine Körperachse wandert, wenn ich «in die Senkrechte» gehe, und hinter meinem Kopf und vor meinen Füssen liegt, wenn ich mich nach vorn beuge. Also ist die Lagewahrnehmung «kopfwärts – fusswärts» deutlich etwas anderes als die Wahrnehmung der Senkrechten. Der Gleichgewichtssinn nimmt wahr, ob die Lage meiner Körperachse in der Senkrechten ist oder nicht. Das ist die erste Polarität, die wir hier gefunden haben: «in der Senkrechten – aus der Senkrechten» Das Erlebnis der Senkrechten, die mit mir im Raume wandert, wenn ich mich bewege, ist eine den Menschen im tiefsten Inneren berührende Wahrnehmung, wenn man übend gelernt hat, sie wach zu erleben.
Die zweite Polarität des Gleichgewichtsspektrums haben wir schon berührt: es ist die Empfindung, dass ich im Gleichgewicht bin und bleiben werde. (Die Koordinierung mit dem Bewegungssinn ist auch hier wieder eine sehr enge.) Man stelle sich die folgende Situation vor. Jemand redet mich mit dem Satz an: «Bitte, setzen Sie sich, hinter Ihnen steht ein Stuhl» Es gibt kaum jemanden, der sich setzen würde, ohne sich nach dem Stuhl umzublicken. Das hängt damit zusammen, dass die Bewegung des Hinsetzens eine zielgerichtete, final orientierte ist und die sichere räumliche Orientierung durch den vorangehenden Blick zur Voraussetzung hat. Man versuche es einmal ohne diesen Blick und man wird merken, wie man durch Tasterlebnisse, Anstossen an den Stuhl usw., sich langsam orientiert und die Hinsetzbewegung so ausführt, dass man die ganze Zeit bewusst im Gleichgewicht bleibt, ohne dieses auch nur einen Augenblick aufzugeben. Das ist anders, wenn ich mich nach einem Blick auf den Stuhl setze. Wird nämlich der Stuhl nach diesem Blick fortgenommen, ohne dass ich es merke, so falle ich hin, wenn ich nicht sehr geschickt bin. Ich setze mich so, dass ich mich in meinem Bewegungsablauf aus dem Gleichgewicht begebe. Die Bewegungsfolge ist dabei so koordiniert, dass das Gleichgewicht in dem Moment wiedergefunden wird, wenn die Berührung mit dem Stuhl einsetzt. Ist das nicht der Fall, findet der Betreffende sein Gleichgewicht erst auf dem Boden wieder.
Die zweite Polarität des Gleichgewichtssinnes, die wir mit den Worten «im Gleichgewicht – aus dem Gleichgewicht» bezeichnen können, begleitet als unbewusst bleibende Wahrnehmung alle Bewegungsabläufe.
Wie der Mensch eine exakte Wahrnehmung der aufrechten Richtung hat, hat er auch eine ebenso exakte Wahrnehmung der horizontalen Ebene. Das ist der Fall, wenn ich mich zum Schlafen hinlege. Auch hier ist – es sei wiederholt – die Lagewahrnehmung von der Gleichgewichtswahrnehmung zu trennen. Dreht man sich aus der Rücken- in die Bauchlage, wandert die Lagewahrnehmung des Bettes vom Rücken über eine Seite zum Bauch, ohne dass die Wahrnehmung der Horizontalebene sich dabei verändert. Die Empfindung des schief stehenden Bettes führt dazu, dass ich schlecht einschlafe. Liege ich auch noch diagonal auf einer schiefen Ebene, so kann mich das lange, wenn nicht sogar überhaupt am Einschlafen hindern. Man sieht, wie die vertikale Richtung zu dem wachen und die horizontale Ebene zu dem schlafenden Menschen gehört. Die Wahrnehmung der Horizontalen ist die einzige Wahrnehmung des Gleichgewichtssinnes, bei der auf die Koordination mit dem die Gliedmassen bewegenden Willen und dem Lagesinn verzichtet werden kann, ohne dass Unsicherheit oder Unruhe den Menschen ergreifen; im Gegenteil: durch dieses Tor zieht sich das Ich aus dem Leibe zurück. Mit der Anwesenheit des Ich im Leibe hängt dagegen die Wahrnehmung der Vertikalen zusammen. Alle drei Polaritäten des Gleichgewichtssinnes – in der Vertikalen – aus der Vertikalen; im Gleichgewicht – aus dem Gleichgewicht; in der Horizontalen – aus der Horizontalen – können sicher und exakt auch mit geschlossenen Augen erlebt werden. Dass die Augen dennoch vom Gleichgewichtssinn gebraucht werden, bemerkt man, wenn im Sehfeld und damit in der Umwelt der Gleichgewichtssinn beteiligt wird. Es lässt sich wahrnehmen, ob ein Mast, ein Baum oder eine Gebäudekante senkrecht stehen oder nicht, ob eine Ebene in der Horizontalen ist oder nicht und ob ein Gegenstand im Gleichgewicht steht oder nicht.
Wie ich durch das statische Organ meinen Leib im Schwerefeld erleben kann, so kann ich über das Auge die Dinge der Umwelt im Verhältnis zu ihm erleben. Beides hängt zusammen, und meine wache Gleichgewichtswahrnehmung in der Umwelt setzt die Tätigkeit des Gleichgewichtssinnes im statischen Organ voraus, was wir aber nicht bewusst wahrnehmen. In dem Verhältnis der Dinge zum Schwerefeld kann ich die gleichen drei Urphänomene wahrnehmen wie in meinem eigenen Verhältnis zu ihm. Damit lassen sich drei Gruppen von Urphänomenen mit je einer auf den Leib und einer auf die Umwelt gerichteten Seite zum Ganzen des Gleichgewichtsspektrums ordnen. Der Gleichgewichtssinn bildet die Tore, die das Ich durchschreitet, um seinen Tagesrhythmus zwischen dem wachen Zustand im Leibe und dem schlafenden, aus dem Leibe herausgezogenen Zustand durchleben zu können.
Die Absolutheit des Geistes findet sich auch in den Phänomenen des Sinnes wieder, der ihm dient: die Wahrnehmungen des Gleichgewichtssinnes sind im absoluten Sinn immer eindeutig, Mischphänomene treten nicht auf.Der Schwere entgegenstehend, das Wachbewusstsein tragend:
- Ich selbst: aufrecht stehen – nicht aufrecht stehen.
- Die Dinge: stehen aufrecht – stehen nicht aufrecht.
Im Schwerefeld sich orientierend:
- Ich selbst: ins Gleichgewicht kommen – aus dem Gleichgewicht kommen.
- Die Dinge: kommen ins Gleichgewicht – kommen aus dem Gleichgewicht.
Der Schwere hingegeben, das Tor zum Schlafbewusstsein bildend:
- Ich selbst: in der Horizontalen liegen – nicht in der Horizontalen liegen.
- Die Dinge: liegen horizontal – liegen nicht horizontal
Zusammenfassung: Die Willenssinne
Zusammenfassung: Die Willenssinne
Blicken wir auf die vier Sinne, die wir eben betrachtet haben: den Tastsinn, den Lebenssinn, den Bewegungs- und den Gleichgewichtssinn, so finden wir auch hier eine zunehmende Polarisierung der Phänomene, ähnlich wie wir es bei den dem Fühlen verbundenen Sinnen entdeckt haben.
Beim Tastsinn lässt sich ein stufenloser Übergang von «glatt» nach «rauh» usw. feststellen. Die Pole «glatt» oder «rauh» werden aber in der Wahrnehmung nie absolut erscheinen, denn es lässt sich immer eine noch glattere oder noch rauhere Empfindung als die faktisch gegebene vorstellen. Doch eine qualitative Steigerung durch Mischung, wie es für den Geruch und den Geschmack selbstverständlich ist, bleibt hier aus. Beim Lebenssinn verschwindet die Mitte zwischen «hungrig» und «satt», Schwere und Leichte usw. in dem allgemeinen Gefühl der Behaglichkeit. Beim Bewegungssinn werden die Pole zu Antagonisten. Entweder ist die Bewegung krumm oder gerade, die Lage links oder rechts. Nur «schnell» bis «langsam» kennt noch eine Übergangsreihe. Beim Gleichgewichtssinn schliesst ein Urphänomen nicht nur seinen Antagonisten, sondern auch das zweite Verhältnis zur Schwere aus. Wenn ich aufrecht stehe, dann stehe ich weder schief, noch liege ich in der Horizontalebene. Diese vier mit dem Willen des Menschen, mit seinem Tätigsein im Tageslauf verbundenen Sinne zeigen eine Verstärkung des antagonistisch-polaren Prinzips; dafür fehlen Steigerungen durch Mischung, die gerade die Hauptsache bei den Gefühlssinnen sind. Die Willenssinne bringen das Absolute des Geistes stärker zum Ausdruck als jene.
Nicht nur für die vier Cefühls-, auch für die vier Willenssinne haben wir gefunden, dass jeder der vier je eine Beziehung zu einem Wesensglied des Menschen hat. Mit dem Tastsinn nehmen wir die Substantialität der physischen Welt wahr. Die Tatsache, dass wir hier nach den Bedingungen zu ordnen hatten, unter denen die Phänomene erscheinen, zeigt die Beziehung zur stofflichen Welt. Zur Arbeitsmethode, die diese Welt erforscht, gehört die genaue Beschreibung der Bedingungen, unter denen die Erscheinungen mit Notwendigkeit und Ausschliesslichkeit auftreten. Durch den Lebenssinn nehmen wir die Zustände wahr, die sich durch die rhythmischen Tätigkeiten des Ätherleibes im physischen Leibe ergeben. Folgerichtig hatten wir hier das Spektrum nach drei Rhythmen zu ordnen. Durch den Lage- und Bewegungssinn nehmen wir wahr, wie sich Seelisches im Verhalten äussert. Hier hatten wir nach der Art, wie Lage und Bewegung seelisch zusammenklingen, zu ordnen.
Schliesslich braucht das Ich die Tore, die es in den Phänomenen des Gleichgewichtssinnes findet, um sich in zwei Seinsarten zum Leib in ein Verhältnis zu bringen.
Gleichgewichtssin, Tor des Geistes
Tastsinn, Mittler der physischen Welt
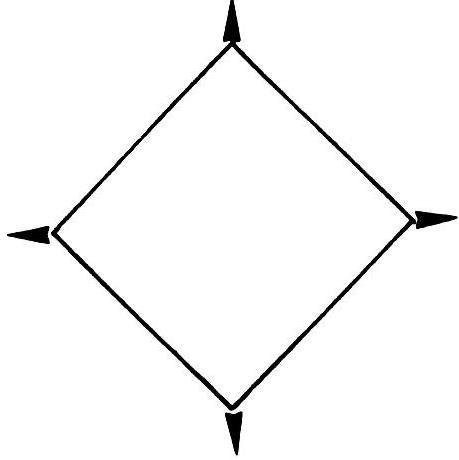
Lage- und Bewegungssinn,
Mittler der seelischen Welt
Lebenssinn, Mittler der eigenen Lebensprozesse
Die Denksinne
Die Denksinne
Es bleibt noch eine dritte Gruppe von vier Sinnen zu besprechen übrig.
Bisher haben wir die Sinne so behandelt, dass wir ihre Erlebnisfelder analysiert und die gefundenen Qualitäten nach in der Sache liegenden Kriterien geordnet haben. Auch im folgenden soll diesem Grundsatz treu geblieben werden.
Wir wollen ihn allerdings so anwenden, dass er uns hilft, die einzelnen Sinnesfelder erst einmal voneinander zu trennen. Denn die Sinne, von denen jetzt gesprochen werden soll, der Hörsinn, der Lautsinn, der Denk- und der Ichsinn, werden in der Regel nicht isoliert voneinander tätig. Auch soll daran erinnert werden, dass wir «Sinn» genannt haben, was zu einem «Spektrum gleichartiger Qualitäten» zusammenzufassen ist – wie Farben, Lebenszustände oder Gleichgewichtswahrnehmungen -, weil wir nach diesem Kriterium auch hier unterscheiden wollen.
Hören wir einem Menschen zu, der spricht, um uns seine Gedanken mitzuteilen. Welche Felder gleichartiger Qualitäten lassen sich in dem unterscheiden, was uns so gegenübertritt? Da sind einmal die Worte, die als das Nacheinander der Lautgestalten auftreten. Ausser den Lautgestalten, die sich aus Vokalen und Konsonanten zu dem bilden, was wir «Wort» nennen, hören wir auch die Bedeutungsweisen, die den Worten anhaften. Ja, wir können sogar sagen, dass es in der Alltagssprache alleiniger Zweck der Worte ist, Vehikel der Begriffsinhalte zu sein. Schliesslich hört man auch die Persönlichkeit, die spricht; man nimmt sie in ihrem Stil, das heisst in ihrer individuellen Denk- und Sprachform wahr. Natürlich muss man den Sprechenden zuvor kennengelernt haben, um seinen Stil aufzufassen. Laut, Gedanke und Stil repräsentieren drei verschiedene Qualitätsfelder und sind daher auch drei verschiedenen Sinnen zuzuordnen. Es ist die Aufgabe der folgenden Betrachtungen, dies durch experimentelle Anordnungen zu zeigen. Zunächst aber soll dargestellt werden, dass die Lautgestalten der Worte etwas anderes sind als die Geräusche, aus denen sie gestaltet werden. Die Qualitätsschicht der Geräusche nehmen wir mit dem Hörsinn wahr, der als vierter Sinn im Hörfeld zu entdecken ist. Die folgende Darstellung wird zeigen, dass wir dem Hörsinn einen kleineren Geltungsbereich zuweisen, als es sonst üblich ist.
Der Hörsinn
Der Hörsinn
Die Qualitäten des Hörspektrums lassen sich nur unvollkommen von denen des Lautsinnes trennen. Einleitend soll diese Tatsache experimentell vorgestellt werden. Der Leser bemühe sich, die Saite einer Violine anzustreichen (für andere Instrumente gilt dasselbe sinngemäss). Welche Möglichkeiten bieten sich, den Grundton dieser Saite zu verändern?
- Die Spannung der Saite lässt sich erhöhen oder herabsetzen; dadurch wird ihr Grundton höher oder tiefer.
- Die Saite lässt sich stärker oder schwächer anstreichen; der Ton wird lauter oder leiser.
- Schliesslich kann man die Saite kurz oder lang anstreichen; der Ton wird kürzer oder länger erklingen.
Unabhängig von der Tatsache, dass die Saite der Violine höher oder tiefer, länger oder kürzer, lauter oder leiser erklingt, ist der «Violincharakter» dabei unverändert geblieben. Dieser Violincharakter, der allen sechs verschiedenen Variationen in ähnlicher Weise anhaftet, muss mit demjenigen zusammenhängen, was in der Experimentalreihe nicht variiert worden ist: mit der Gestalt des benutzten Instrumentes. So bleibt es auch bei allen anderen Instrumenten und klingenden Objekten, ja selbst bei Sprache und Gesang ist es nicht anders. Wir finden, dass es zwei verschiedene Gruppen von Qualitäten sind, aus denen sich alles,was im Hörraum erscheint, zusammensetzt. Diese lassen sich nicht völlig voneinander trennen, weil das erklingende Objekt immer auch eine Gestalt hat, die als Charakter des Tones in das Gehörerlebnis eingeht. Was diesen Charakter nun ausmacht, nimmt der Lautsinn auf. Die Frage, aus welchen Urphänomenen er sich zusammensetzt, wird im Anschluss an den Hörsinn behandelt. Sucht man eine Erscheinung im Hörfeld, welcher der Charakter des Lautes weitgehend fehlt, so horche man auf das sogenannte graue Rauschen, das sich durch ein Radiogerät erzeugen lässt.
Wir wenden uns zunächst den drei Polaritäten «hoch – tief», «lang – kurz» und «laut – leise» zu, die zusammen das Spektrum des Hörsinnes ausmachen, um herauszufinden, was dessen Qualitäten erzeugt. Dabei stellen wir wiederum die Frage, welche Schicht der Welt sich durch den Hörsinn erschliesst.
Hoch – tief
In die Tonhöhe gehen bestimmte Eigenschaften des klingenden Materials ein, die man (äussere oder innere) Spannung und spezifisches Gewicht nennt. Erhöht sich die Spannung, steigt der Ton; erhöht sich das spezifische Gewicht, fällt er, und zwar in einem mathematisch ausdrückbaren Verhältnis: wird die Spannung um das Vierfache erhöht, steigt die Tonhöhe um eine Oktave (und umgekehrt). Steigt das spezifische Gewicht dagegen um den vierfachen Betrag, sinkt die Tonhöhe um eine Oktave. Die Tonhöhe bildet sich daher aus dem Verhältnis, in dem die Spannung zum spezifischen Gewicht des klingenden Objektes steht. Das gilt allerdings nur für Objekte mit kleinem Querschnitt. Das sind Saiten mit äusserlich erzeugter Spannung. Für feste Stäbe gilt die Aussage unabhängig davon, ob sie an der Stirnseite angeschlagen werden – dabei entstehen Dehnungsschwingungen -, oder ob sie quer angeschlagen werden, wodurch Biegungsschwingungen hervorgebracht werden. Das Fell einer Trommel (mit Aussenspannung) oder ein Blech aus Metall (mit Innenspannung) zeigen Verhältnisse beim Erklingen, die komplizierter sind als die eben beschriebenen. Was aber vor allem auffällt, ist, dass man die Tonhöhe nicht scharf hört, in der die zuletzt genannten Objekte klingen. Es bildet sich zum Grundton eine ganze Fülle von Obertönen, die ihn überdecken und die den spezifischen Klang des Objektes ausmachen: das gleiche Phänomen, das wir schon bei unserem Experiment mit der Violine gefunden haben und das mit der Gestalt des klingenden Körpers zusammenhängt.
Laut – leise
Auch hier sind es wieder zwei Elemente, die ein Verhältnis zueinander bilden, aus dem die Intensität eines Tones folgt. Einmal geht die Grösse der Anregung in die Lautstärke ein. Je heftiger der Stab angeschlagen oder die Saite angestrichen wird, um so lauter erklingen sie. Je weicher das Material des Objektes ist, um so leiser tönt es. Man denke dabei an das spröde Glas oder den spröden Stahl im Gegensatz zum weichen und plastischen Blei. Die Härte oder Sprödigkeit eines Körpers hat auch einen Einfluss darauf, ob er
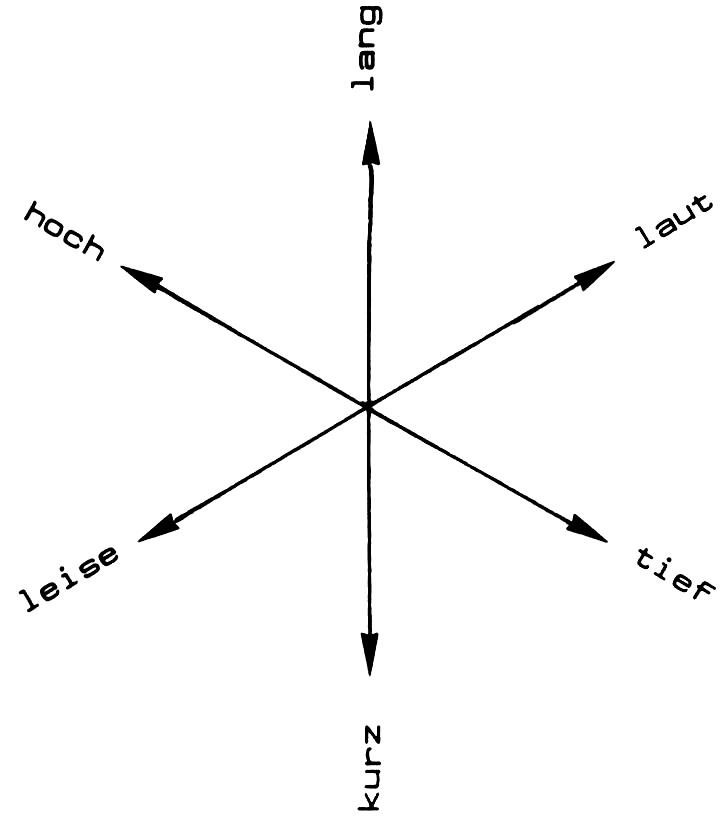
lang oder kurz
erklingt. Je spröder das Material ist, um so länger klingt der erzeugte Ton. Zum zweiten hat die absolute Grösse des erklingenden Körpers einen Einfluss: je grösser oder länger der Körper ist, umso länger erklingt er. Das gilt auch für den Raum, in dem der Ton erklingt. In einer leeren grossen Halle erklingt ein auf die gleiche Art erzeugter Ton länger als in einem kleinen engen Raum. Wenn es richtig ist, dass ein Ton nicht erzeugt werden kann, ohne dass ihm ein bestimmter Charakter anhaftet, dann lassen sich auch ausser diesem Charakter keine weiteren aus den Materialeigenschaften und der Grösse hervorgehenden Variablen finden als die drei genannten Polaritäten, die wir folgendermassen ordnen wollen:
In der Tiefe und in der Höhe kann ein Ton aus dem Hörraum verschwinden. Geht er hoch hinaus, tritt Schmerz auf, in der Tiefe kann es sein, dass das Hören in ein rhythmisches Tasterlebnis übergeht. In der Polarität «laut – leise» kann ein Schmerzerlebnis auftreten, wenn der Ton zu laut wird. Durch das Leiserwerden verschwindet der Ton dagegen unmerklich aus dem Hörraum. Die Polarität «lang – kurz» bewegt sich zwischen Knall und schwebendem Ton und ist das Material, aus dem sich in der Musik der Rhythmus bildet, weshalb diese Polarität in die Mitte zwischen «hoch – tief» und «laut – leise» gestellt wurde.
Die Frage nach der Wesensschicht, die sich uns im Hörerlebnis offenbart, ist nun zu beantworten: es sind die inneren physikalischen Eigenschaften der festen Stoffe, es ist somit die physische Welt. Nicht der Schein der physischen Welt offenbart sich, es offenbaren sich ihre inneren Eigenschaften. Ob ein Hammer aus Styropor oder Stahl ist, offenbart sich an der Antwort, die er gibt, wenn ich ihn anschlage. Bergleute klopften früher die hölzernen Stempel an, mit denen das Hangende abgestützt war, und hörten, ob sie sicher waren oder nicht.
Der Lautsinn
Der Lautsinn
Die Besprechung des Hörsinns wurde mit einem Experiment zur Unterscheidung der Qualitäten des Hör- und des Lautsinnes eingeleitet. Wir wenden uns nun demjenigen zu, was wir «Violincharakter» und danach verallgemeinernd «Charakter des Tones» genannt haben.
Man höre einem sprechenden Menschen mit der Intention zu, wahrnehmen zu wollen, wie sich die Tonhöhe in der Sprache verhält. Dieser Versuch erweist, dass wir nicht daran gewöhnt sind, auf diese Seite der Sprache zu achten. Ob und wie der Grundton im Laufe eines Satzes steigt oder fällt, wird uns erst jetzt bewusst. Dieses mit dem Hörsinn aufgenommene Phänomen ist aber nur dort von Bedeutung, wo die Sprache künstlerisch gestaltet wird. So ist es auch mit «laut -leise» und «lang – kurz» bei den Tönen. Erst wenn die Lautstärke eine bestimmte Intensität über- oder unterschreitet, wachen wir dafür auf; ebenfalls, wenn die Sprache zu lang gedehnt wird oder in ein zu kurzes Staccato übergeht. Beim Sprechen, wie es unter Menschen üblich ist, schlafen wir für den Hörsinn mit seinen sechs Phänomenen vollständig. Dagegen wachen wir für die Obertöne und dasjenige, was aus ihrer Komposition hervorgeht. Das aber sind die Wörter; es ist ihr Klang, der durch die verschiedenen Stellungen und räumlich-zeitlichen Verwandlungen hervorgebracht wird, die unsere Sprachorganisation beim Sprechen durchmacht. Auf die einzelnen Laute unserer Sprache haben wir zu achten, wenn wir kennenlernen wollen, welche Vielfalt an Lautbildungen möglich ist. Ehe wir uns der Frage zuwenden, ob der charakteristische Laut eines Musikinstrumentes einem aus Konsonanten und Vokalen gebildeten Wort vergleichbar sei, beschäftigen wir uns mit den Sprachwerkzeugen, die die Obertöne räumlich und zeitlich gestalten, um Gliederungsgesichtspunkte für die Laute der Sprache zu finden.
Der Kehlkopf, ein ausserordentlich komplex arbeitendes Organ, bringt Stimme in die Sprache, erzeugt die Sonanten (Vokale und stimmhafte Konsonanten). Die Vokale werden durch die verschiedene Stellung von Unterkiefer, Zunge und Lippen zur Wölbung der Mundhöhle gebildet. Diese vorderen Sprachwerkzeuge gestalten durch ihre Stellung zueinander den Sprachstrom, der aus der vom Willen ergriffenen Lungenorganisation herandringt. Von A über E, I, O, U schliesst sich die Mundhöhle zunehmend, und die Tonbildung rutscht vom Gaumen zu den Lippen.
An Gaumen, Zähnen und Lippen werden auch die verschiedenen Konsonantentypen angesetzt, unabhängig davon, ob sie durch den Kehlkopf stimmhaft vorgebildet werden oder nicht. Hier haben wir fünf Gruppen zu unterscheiden, je nach der Art, wie der dynamische Atemstrom, das Sonantische und die Gestalt der vorderen Sprachwerkzeuge zusammenarbeiten. Diejenigen Laute, bei denen der Atemstrom die geschlossene Sprachorganisation einmal durchbricht, sind die Stosslaute, zum Beispiel G und K, die sich nur im weichen oder harten Ansatz des Stosses am Gaumen unterscheiden; entsprechend ist es bei D und T, die an den Zähnen, und B und P, die an den Lippen ansetzen. Ihnen stehen die Blaselaute gegenüber, die sich ebenfalls in Gaumen-, Zahn- und Lippenlaute gliedern lassen, unabhängig davon, ob sie stimmhaft oder stimmlos gesprochen werden. Bei ihnen ist die Sprachorganisation von vornherein geöffnet.
- Gaumen: H (stimmlos) und Ch (schwach stimmhaft).
- Zahn: Z und scharfes, stimmloses S und stimmhaftes S.
- Lippen: F und V (stimmlos), W (stimmhaft).
Das R ist ein Laut, für dessen Erzeugung sowohl Gaumen wie Zunge oder Lippen durch das Zusammenspiel von Atemstrom und verschliessenden Sprachwerkzeugen zum Zittern gebracht werden. Dazu kommt, dass das R an den drei Ansatzstellen sowohl stimmhaft wie stimmlos gesprochen werden kann. Dadurch ist das R der reichste Laut überhaupt.
Ähnlich kommt auch das L zustande, es bildet sich bei etwas quer geöffnetem Mund durch ein Hochschlagen der Zunge gegen verschiedene Stellen an Zähnen und Gaumen. Dabei umfliesst der Atemstrom stimmhaft die Zunge links und rechts. Der hochschlagenden Zungenbewegung wegen soll das L, einen Vorschlag Rudolf Steiners aufgreifend, Wellenlaut genannt werden.
Bleibt noch eine letzte Gruppe von Konsonanten, die insofern nicht in das bisher gewonnene Bild passt, als sie bei geschlossenem Munde gesprochen werden. Es ist M, N und Ng. Beim Ng verschliesst der weiche Gaumen die Mundhöhle, beim N verschliessen die Zunge und die Zähne, beim M die Lippen. Dabei verlässt der Atemstrom die Sprachorganisation durch die Nase, weshalb wir sie Nasenlaute nennen wollen. An den gewonnenen sechs Gruppen von Lauten, den Vokalen, Stosslauten, Blaselauten, Zitterlauten, Wellenlauten und Nasenlauten lassen sich drei Polaritäten entdecken. Die den Vokalen gemeinsame Sprachgeste beruht auf der vollkommen geöffneten Sprachorganisation, ohne besonderen Eingriff von Lippen, Zähnen oder Zunge in den Sprachstrom. Polar dazu sind die Nasenlaute zu sehen, die durch die vollkommen geschlossene Sprachorganisation gebildet werden. Eine zweite Polarität findet sich, wenn wir Stoss- und Blaselaute vergleichen. Die Blaselaute beruhen auf dem ungehinderten Sprachstrom, der durch Lippen, Zähne und Zunge gestaltet wird.
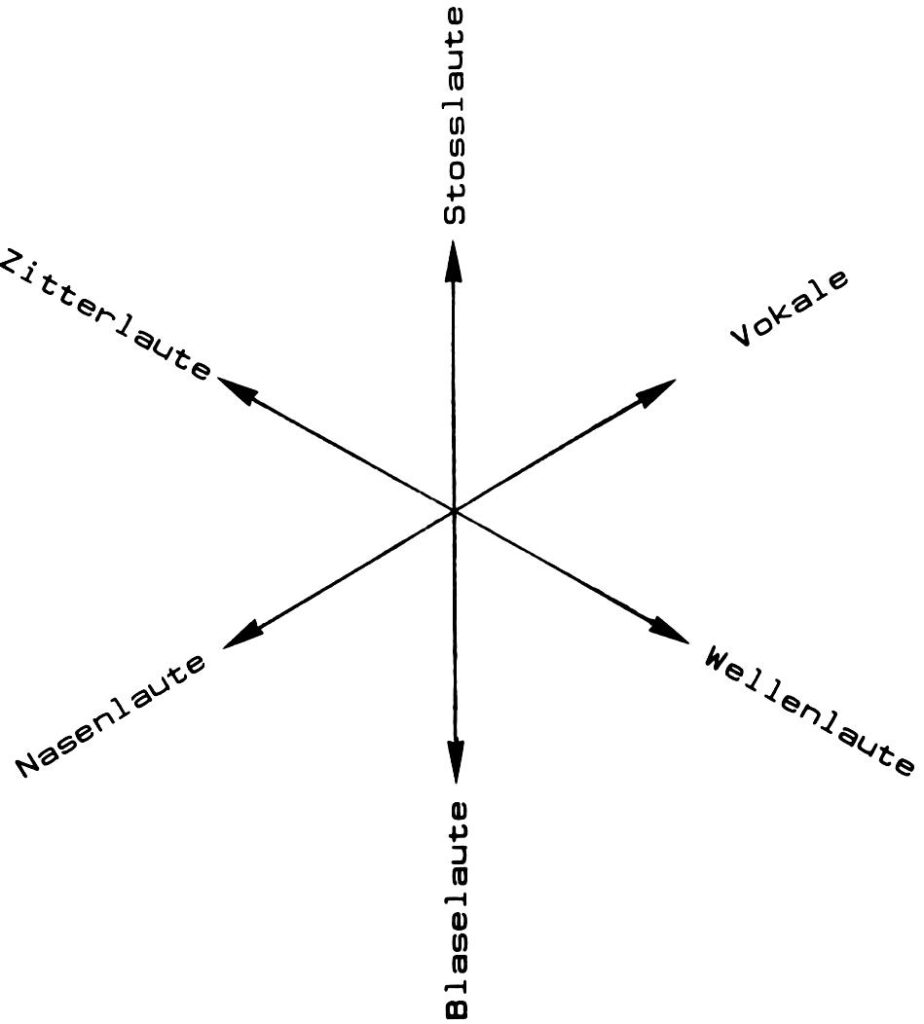
Wieder ist es bei den Stosslauten so wie bei den Nasenlauten: sie werden mit geschlossener Sprachorganisation gebildet, und der Laut erklingt, wenn dieser Verschluss vom Atemstrom durchbrochen wird. Auch Wellenlaut und Zitterlaute verhalten sich ähnlich zueinander. Der Wellenlaut fliesst ungehindert um die an das Gaumendach gehobene Zunge, die Zitterlaute werden mit geschlossener Sprachorganisation gebildet, und der Atemstrom durchbricht den Verschluss rhythmisch. Wir haben daher in jeder der drei Polaritäten ein Überwiegen der gestaltend stauenden, beziehungsweise ein Überwiegen der dynamisch strömenden Anteile der Lautbildung. Wir können nun die Polarität von Zitter- und Wellenlaut, die sowohl das stauende wie das strömende Sprachelement enthalten, in die Mitte des Lautsinnspektrums stellen:
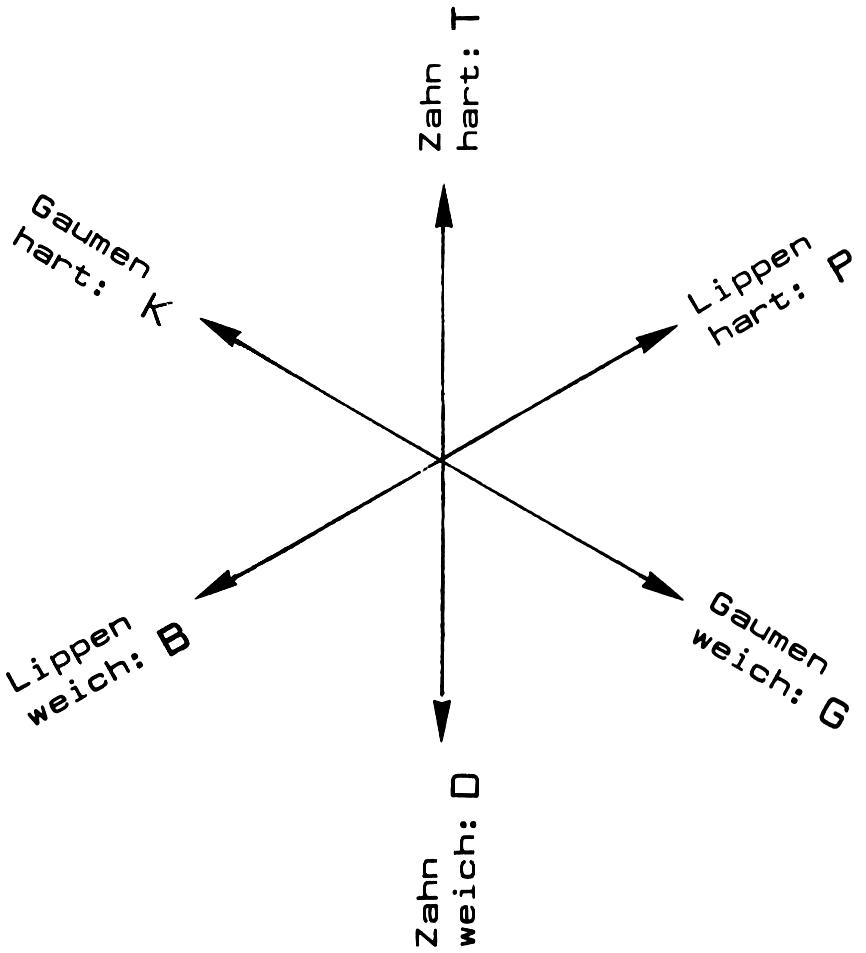
Das aus drei Polaritäten gebildete Spektrum des Lautsinnes unterscheidet sich von allen bisher beobachteten Spektren dadurch, dass jede Polarität auf verschiedene Weise erscheinen kann. Die Stosslaute zum Beispiel können an drei Stellen des Mundraumes gebildet werden, und zwar weich oder hart. Man sieht, dass jede Polarität wieder in ein ganzes Spektrum aufzulösen ist, wenn wir die weich / hart gesprochenen Laute einer Gruppe einander gegenüberstellen:
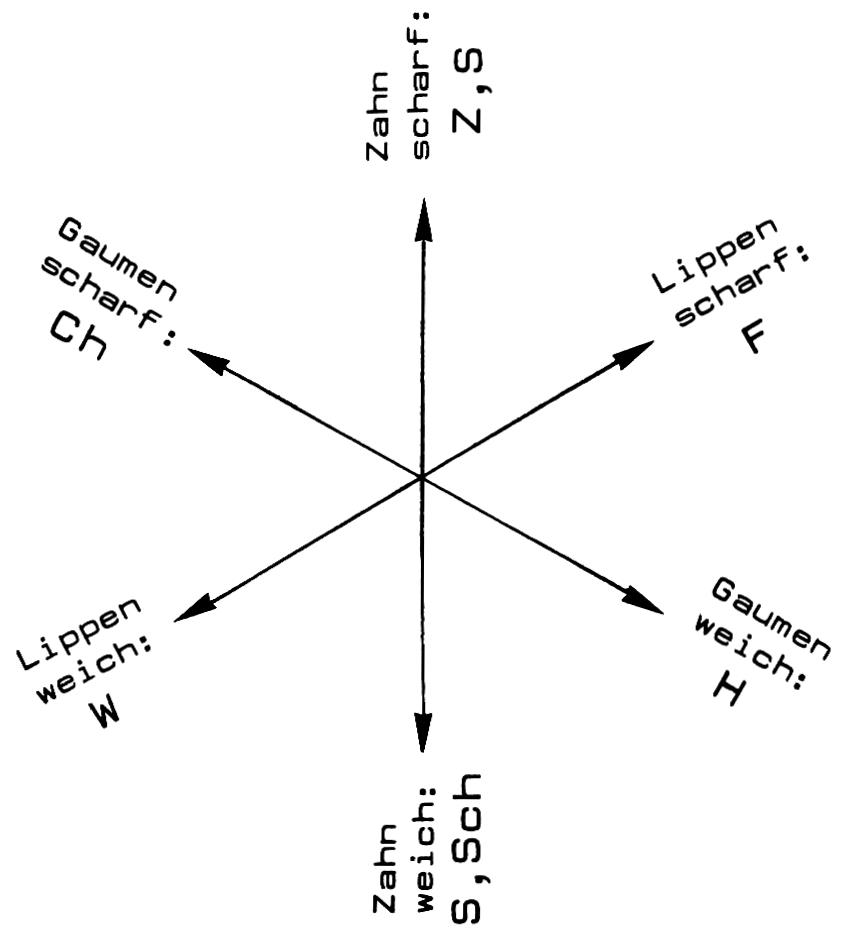
In gleicher Weise lässt sich auch ein Spektrum der Blaselaute bilden:
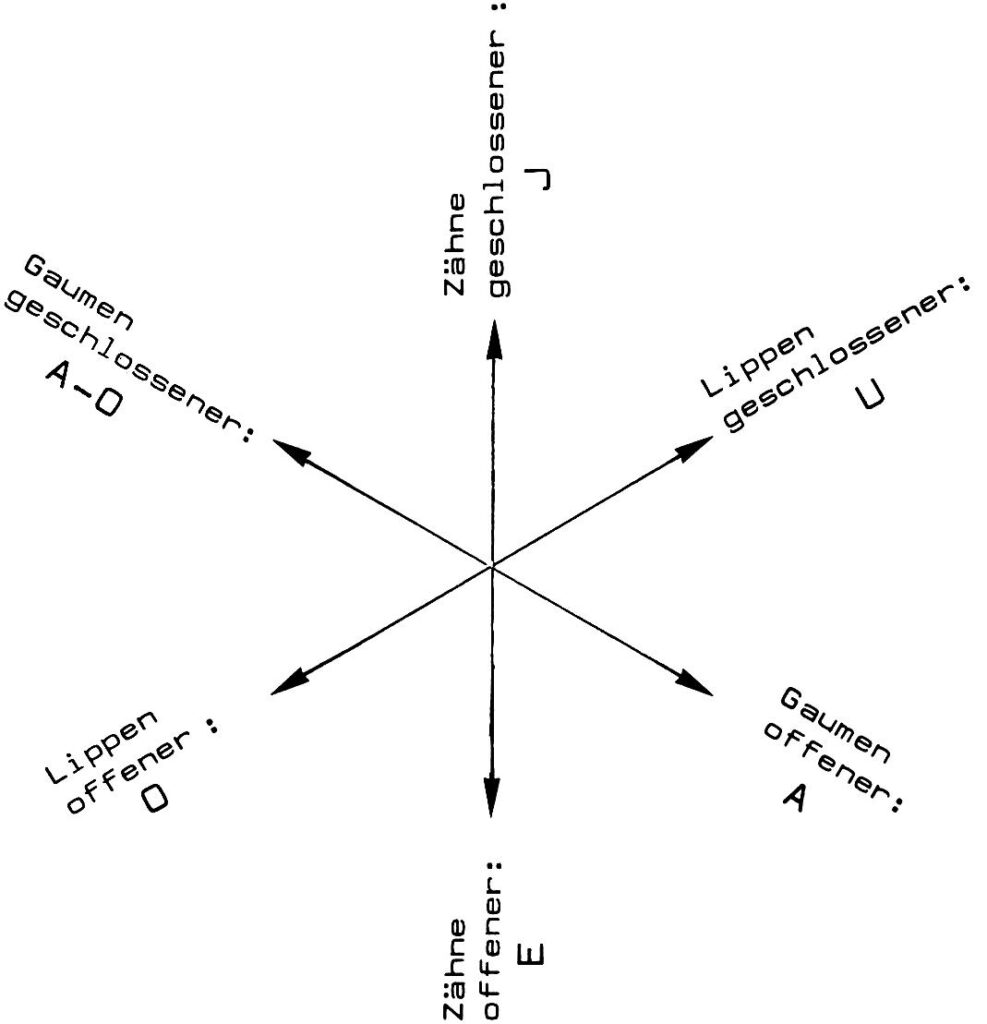
Auch bei den Vokalen finden wir ein ähnliches Spektrum, wenn wir bedenken, dass O und U an den Lippen, E und I an den Zähnen und A am Gaumen gesprochen werden. Nur fehlt ein zweiter Vokal am Gaumen, den wir so dem offenen A gegenüberstellen können, wie das geschlossener gesprochene I und U dem offener gesprochenen E und O gegenüberstehen. Wir hören diesen Vokal, der in einer geschlosseneren A-Stellung erklingt, als eine Lautbildung zwischen A und O.
Die Spektren der restlichen drei Lauttypen sind ärmer. Die Nasenlaute haben an jeder Stelle, wo sie gebildet werden, nur einen Laut.
Der Zitterlaut R ist zwar an allen drei Stellen hervorzubringen (stimmhaft oder stimmlos) bleibt aber dem Klangcharakter nach immer R.
Der Wellenlaut L ist der einzige seines Spektrums:
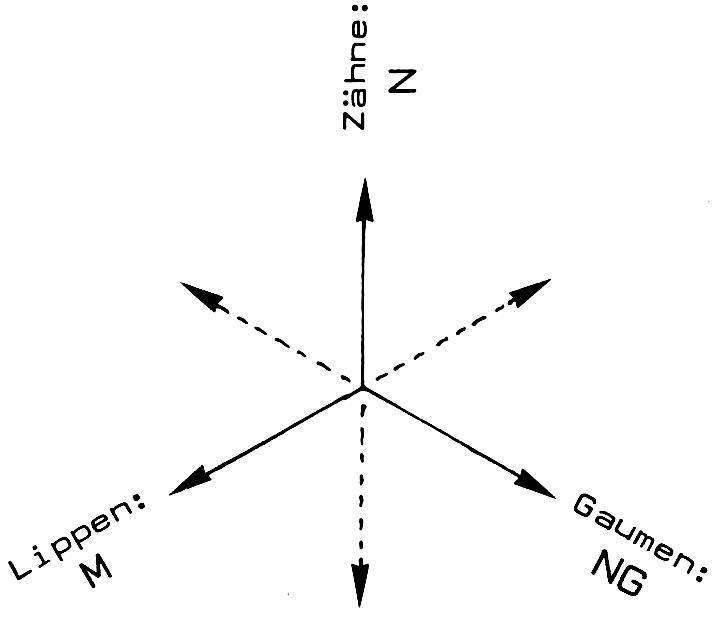
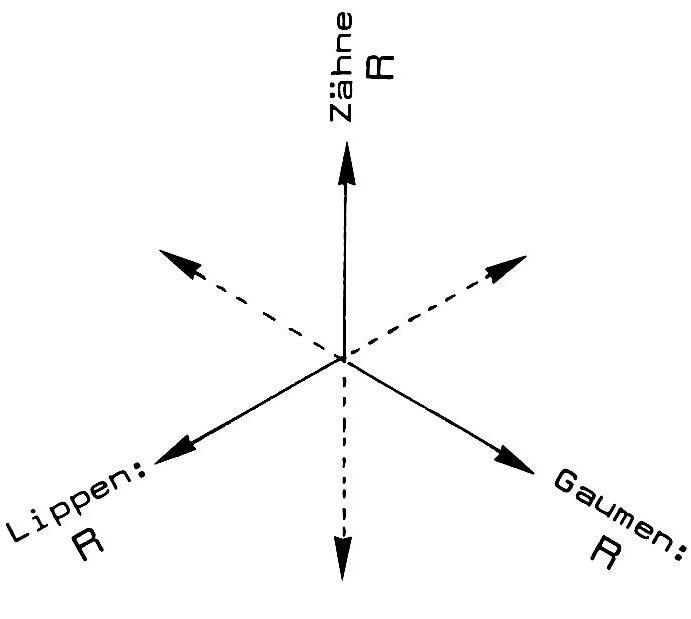
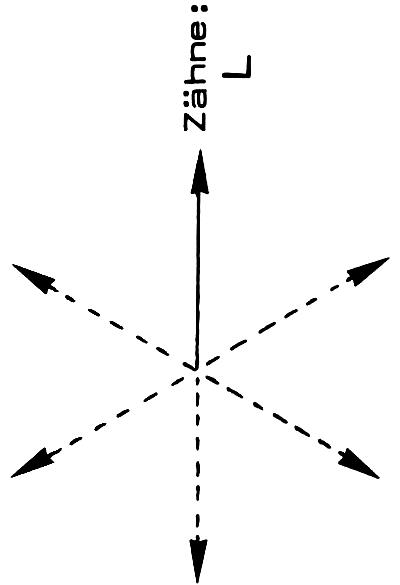
Die Betrachtung der Laute, die unseren Sprachen zugrunde liegen, zeigt, dass es vor allem die räumliche Vielgestaltigkeit – Lippen, Zähne, Zunge, Gaumen und Unterkiefer – ist, welche die sich aus Obertönen bildenden Laute gestaltet. Ein Phänomen, auf das wir erstmals bei der Besprechung des Violintons aufmerksam geworden sind. Wir greifen dieses Thema hier wieder mit der Frage auf, wie sich die für einzelne Instrumente typischen Lautgestalten beschreiben lassen.
Im Reigen der Musikinstrumente unterscheiden wir Blas-, Saiten- und Schlaginstrumente. Die Blasinstrumente lassen sich wiederum in Blech- und Holzblasinstrumente gliedern, letztere in Lippen- und Zungen-Holzblasinstrumente (zu ersteren zählt zum Beispiel die Blockflöte, zu letzteren die Klarinette).
Bei den Saiteninstrumenten wiederholt sich insofern der Reigen der Musikinstrumente, als es hier Streichinstrumente (Violine), Zupfinstrumente (Zither), und Schlaginstrumente (Klavier), gibt.
Die Schlaginstrumente kann man in Membranophone, die wie die Saiteninstrumente einen Resonanzkörper haben, und in Idiophone oder Selbstklinger gliedern. Zu ersteren zählt zum Beispiel die Trommel, zu letzteren das Xylophon.
Wir wollen das Erlebnis im Hörfeld untersuchen, das beim Ertönen verschiedener Musikinstrumente wahrzunehmen ist, um auf die Urphänomene aufmerksam zu werden, aus denen sich der charakteristische Klang oder, wie wir noch finden werden, die charakteristische Klangbreite verschiedener Musikinstrumente zusammensetzt. Dabei sehen wir bewusst vom musikalischen Klangerlebnis ab, indem wir unsere Intention allein auf den Lautsinn richten und auf den Hörsinn nicht achten.
Blockflöte
Richten wir in diesem Sinn unser wahrnehmendes Interesse auf einen beliebigen Ton der Blockflöte, so lässt sich ein Anblaslaut erkennen sowie das Zusammenspiel vokalischer und konsonantischer Komponenten, während der Flötenton seine Lautgestalt in der Zeit ausbildet. Betont man den Anblaslaut, bekommt die Lautgestalt die besondere Form des Staccato, unterdrückt man ihn durch weiches Anblasen weitgehend, erscheint die Lautgestalt in der Form des Legato. Im Staccato erscheint als Anblaslaut tiefer Töne ein D, als solcher hoher Töne ein T. Das ist sowohl bei der Tenor-, der Alt- und der Sopranblockflöte so. Die Lautgestalt tiefer Töne wird von einem U getragen, das sich mit steigender Tonhöhe über O und A, Ü und I entwickelt. Die jeweils tiefsten Lautgestalten werden bei der Sopranblockflöte vom U, bei der Altblockflöte vom O und bei der Tenorblockflöte vom Ü getragen. Eine Konsonantenbeteiligung ist nur sehr schwach zu hören. An den Lautgestalten guter Flöten ist ein H, bei schlechteren ein Ch beteiligt. Beim Anblasen aller Blockflöten im Legato setzt ein H ein. Die charakteristische Lautgestalt der Blockflöten scheint auf diese Weise vollständig beschreibbar zu sein. Auch bei gründlicher Prüfung tritt neben den Vokalen und Konsonanten, aus denen sich auch unsere Sprache bildet, nichts anderes in den Hörraum. Allerdings ist es so, dass sich das «Wort», das die Flöte «spricht», gegenüber den Wahrnehmungen durch den Hörsinn, dem «hoch-tief» der Töne usw., im Hintergrund hält und erst dann hervortritt, wenn wir darauf achten. Dabei hängt die Wahrnehmung mit von der Intention ab, mit der wir hören: ob unsere Erwartung beim Achten auf den Anblaslaut auf D oder auf T gestimmt ist. Daher muss man durchprobieren, bei welcher Hörintention die Wahrnehmung am deutlichsten ist.
Was wir hier für die Flöten gefunden haben, gilt auch für alle anderen Instrumente.
Klavier
Auch hier unterscheiden sich Staccato und Legato allein durch den Anschlaglaut; allerdings ist der Unterschied bedeutend geringer als bei der Blockflöte. Im Staccato lässt sich als Anschlaglaut bei tiefen Tönen ein Laut, der zwischen G und K liegt, hören, bei Tönen mittlerer Höhe ein Laut zwischen T und P, bei hohen Tönen ein T. Im Legato beginnt der Anschlaglaut in der Tiefe mit B und wandelt sich über D in T und ist hier kaum mehr vom Staccato zu unterscheiden.
Getragen wird die ganze Lautgestalt der Klaviertöne sowohl von einem Vokal als auch von einem kaum oder doch nur wenig schwächeren Konsonanten. In der Tiefe beginnt die vokalische Komponente mit AU und wandelt sich im Verklingen in O um. Etwas höhere Lautgestalten klingen mit A auf, das sich ebenfalls in ein O verwandelt. Es folgen solche, die allein vom O getragen sind. Mit steigender Tonhöhe folgt ein reines E, dem sich mehr und mehr ein I beimischt, das dann in den höchsten Tönen allein rein erklingt.
Die konsonantische Komponente tiefer Lautgestalten besteht aus einem R, das mit steigender Tonhöhe in M mit R, darauf in M, dann in M mit N, in reines N und schliesslich in Ng übergeht.
Während die Lautgestalt der Violine auf- und abschwellen kann – eine Variation, die der Hörsinn aufnimmt -, ist beim Klavier der Anschlagton immer der lauteste, und die Lautgestalt als Ganzes klingt während ihrer Erscheinung ab.
Kleine Pauke
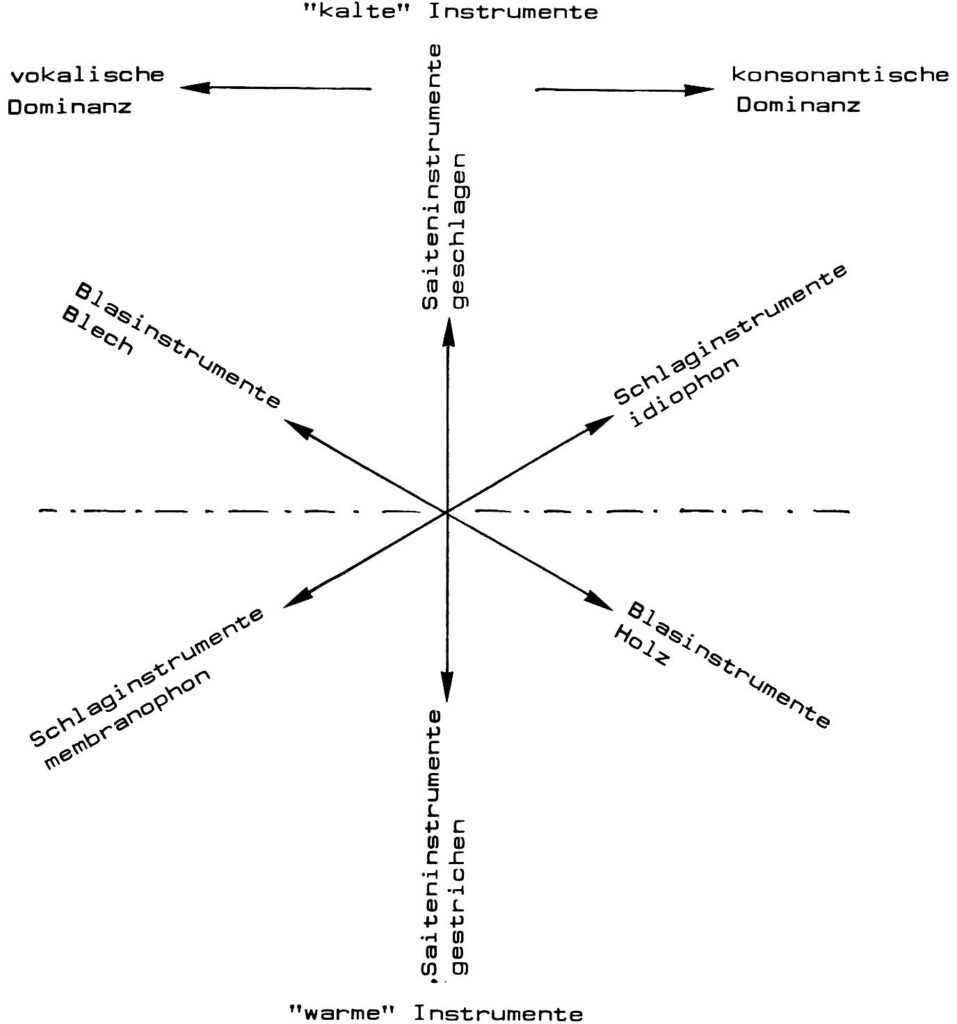
Als Beispiel für die Schlaginstrumente diene die kleine Pauke. Sie lässt einen beschreibbaren Unterschied zwischen Staccato und Legato nicht mehr erkennen. Der Anschlaglaut ist immer ein T, unabhängig davon, ob die Pauke in der Mitte oder am Rande angeschlagen wird. Der Vokal trägt die Lautgestalt weniger als der Konsonant, der dazutritt. Wird die Pauke in der Mitte angeschlagen, erscheint ein offenes O (wie im Wort «Koffer»), wird sie am Rande angeschlagen, ein klingendes AU. Der tragende Konsonant ist, in der Mitte angeschlagen, ein kurzes Ch (wie in «ach»). Am Rande angeschlagen, trägt ein M die ganze Lautgestalt, das länger klingt als der vokalische Anteil AU. Stimmt man die Pauke tiefer, klingt, in der Mitte angeschlagen, die Lautgestalt P O Ch, am Rande P O A M. Aus dem Anschlag T ist ein P geworden. Die Anschlagstärke, so kann man finden, verändert stark den Vokal. Ein starker Anschlag verstärkt das A, ein geringer lässt es verschwinden.
Im ganzen lässt sich durch die Reihe der Musikinstrumente eine charakteristische Metamorphose der Lautgestalttypen erkennen. Die Blasinstrumente zeigen die vokalischen Lautgestalten, die Saiteninstrumente variieren um den Ausgleich von vokalischen und konsonantischen Anteilen; bei den Schlaginstrumenten dominieren die Konsonanten.
Damit ist es möglich, die Erfahrung, die der Lautsinn an den Musikinstrumenten macht, in ein Spektrum zu bringen:
Verglichen mit der menschlichen Sprache hören wir beim Erklingen eines Instrumentes eine Lautgestalt, die den Wert eines Wortes hat. Die Pauke erklingt P O A M, das Klavier T A Z O R R und die Flöte T O H – jeweils mit den tiefsten Lautgestalten. So wie sich das Wort der Musikinstrumente aus dem gleichen Lautschatz bildet wie die menschliche Sprache, so entstehen auch alle Lautgestalten, die in der Natur zu hören sind. In der anorganischen Natur erklingen vor allem die Konsonanten, in der beseelten Tierwelt treten
Vokale hinzu. Im Rauschen des Wassers und des Windes leben die Blaselaute auf, im Murmeln der Quellen der Wellenlaut L, im tropfenden Wasser gelegentlich ein Stosslaut, der zusammen mit dem L wie B L A oder B L U P P klingen kann. Der nächtliche Wald lebt vom K knackender Äste, das aus der Stille hervorbricht.
Bei den Tierlauten finden wir das I, das den Pfiff der Maus durchzittert, das I A U im Miauen der Katze und das U im tief aus dem Bauch kommenden Muhen der Kuh. Es wird nunmehr deutlich, wie die menschliche Sprache alles in sich vereint und in die Vollkommenheit der Lautgestaltung bringt, was aus Natur und Musik im Hörraum zu vernehmen ist. Auf eine bewundernswert vollkommene Weise krönt die menschliche Sprache die Schöpfung im Reich der Zeitgestalten der Laute.
Die Sprache ist bisher unabhängig von ihrer Bedeutung aufgefasst worden. Jedes Wort stellt eine individualisierte Lautgestalt dar, die sich aus den 6 Urphänomengruppen bildet, die der Lautsinn aufnimmt. Eine Wortdichtung Christian Morgensterns kann nicht nur zur Erheiterung, sondern auch zur Übung hierher gesetzt werden:
Das grosse Lalulã
Kroklokwafzi? Semememi!
Seiokrontro – prafriplo:
Bifzi, bafzi; hulalemi:
quasti basti bo…
Lalu, lalu lalu lalu la!Hontraruru miromente
zasku zes rü rü?
Entepente, leiolente
klekwapufzi lü?
Lalu lalu lalu lalu la!Simarar kos malzipempu
silzuzankunkrei (;)!
Marjomar dos: Quempu Lempu
Siri Suri Sei []!
Lalu lalu lalu lalu la!
Der Lautsinn kann nicht nur das Material bearbeiten, das ihm der Hörsinn liefert, er kann sich auch dem Material des Sehsinnes oder auch des Tastsinnes zuwenden. Das Lesen ist eine Aktivität, die den Übergang der Lautsinntätigkeit vom Hören zum Sehen zum Inhalt hat. Besinnen wir uns zunächst auf eine allbekannte Erfahrung: beim Lesen, das wir ja gelernt haben, tragen wir diejenigen Sprachvorstellungen an die mit den Augen fixierten Buchstaben heran, die durch diese symbolisiert werden. Es handelt sich um Vorstellungen, und nicht um Wahrnehmungen, denn der Bewusstseinsort für die sprachliche Seite des Lesens ist im Inneren der Seele, und nicht auf der Buchseite. Auf der Seite des Buches, das der Leser in diesem Augenblick liest, sind nur die sichtbaren Figuren der Buchstaben zu finden, die das Auge beim Lesen zusammenfasst. Trotzdem unterscheiden sich die beim Lesen erzeugten Vorstellungen von den beim Denken hervorgebrachten, weil sie als etwas Fremdes in die Seele eintreten und dadurch Wahrnehmungscharakter behalten. Der Denksinn kann sie in gleicher Weise beobachten wie die Begriffsinhalte, die durch das Hören wahrgenommen werden. Lesen ist die Fähigkeit, jedem Buchstaben einen bestimmten Lautwert zuzuordnen und jeder Buchstabengruppe eine zugehörige Lautgestalt. Das Sehen der Buchstaben ist etwas anderes als das Vermögen, sie vorstellend in Lautgestalten umzusetzen. Wir wenden uns von der vorstellenden Seite des Lesens ab und der Wahrnehmung der Buchstabengestalten zu. Wie beim Hören von Worten lassen sich auch hier zwei Qualitätsarten voneinander unterscheiden. Was am Buchstaben und am weissen Papier, auf dem er stehen mag, hell und dunkel ist, nimmt der Sehsinn wahr, wenn er sich der Schrift zuwendet. Dass «hell» als Untergrund und «dunkel» als Buchstabengestalt erscheint, gehört einer anderen Wahrnehmungsqualität an. So wie die Lautgestalt im Hörfeld von anderer Qualität ist als «hoch – tief», «laut – leise» und «kurz – lang» – was der Hörsinn aufnimmt -, so ist die Gestalt im Sehfeld etwas anderes als «hell- dunkel». Wir wollen daher den Sinn, der im Sehfeld die Gestalten erfasst, vorläufig «Gestaltsinn» nennen und uns darum bemühen, seine Arbeitsweise kennenzulernen. Dabei ist unmittelbar einleuchtend, dass dieser Sinn nicht nur Buchstabengestalten auffasst, sondern jede Gestalt, die im Sehfeld erscheint. Diese Tatsache wird uns die Möglichkeit geben, die Urphänomene des Gestaltsinnes auch aufzusuchen, wenn wir auf diese Frage zurückkommen. Wir stellen hier noch einmal fest, dass «Lautsinn» und «Gestaltsinn» zwei Arbeitsweisen eines Sinnes sind, dessen Tätigkeit, allgemein formuliert, darin besteht, die Gestaltwahrnehmung aus dem zugrunde liegenden Material, das der Hör- oder der Sehsinn liefert, herauszuholen. Er fasst die Gestalten sowohl des Hör- wie des Sehfeldes auf. Versuchen wir, die Tätigkeit des Gestaltsinnes im Sehfeld zu isolieren, um ihn dadurch von den sonst mitwirkenden Sinnen zu trennen.
Die (in Abbildung 4;-) dargestellte Zeile aus schwarzen Gestalten betrachte man mit der Frage, ob es dem Blick leicht oder schwer fällt, die Aufmerksamkeit auf den hellen Hintergrund zu richten und von den dunklen Gestalten abzusehen. Die Übung zeigt, dass es leichter ist, die dunkle Gestaltenreihe zu sehen und für den hellen Hintergrund zu schlafen, als umgekehrt. Wie mit magischer Gewalt ziehen die dunklen Flecken den Blick auf sich; das Ich, das eine andere Intention hineintragen will, kann sich von ihnen beherrscht erleben. Wer dieses Experiment vermannigfaltigt, indem er beispielsweise bei gleichem Augenabstand die dunklen Gestalten vergrössert oder verkleinert, wird zu dem Ergebnis kommen: je kleiner die dunklen Gestalten werden – das gilt bis etwa 3 mm Höhe bei einem Augenabstand von 50 cm -, umso deutlicher drängen sie sich in die Wahrnehmung.
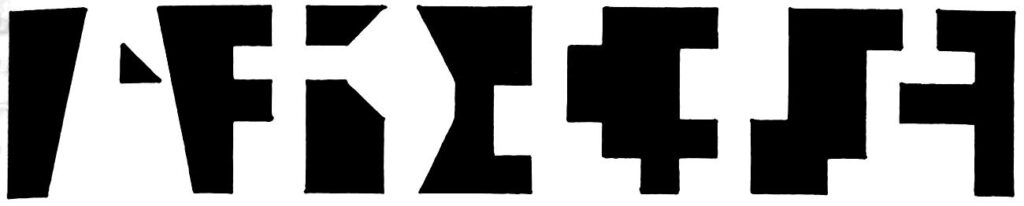
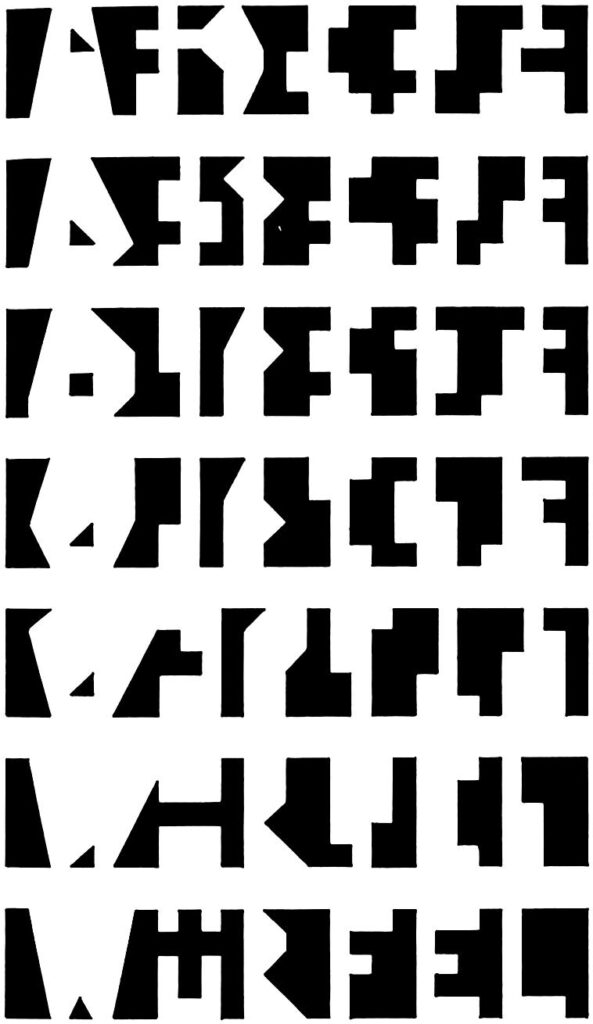
4) Diese Reihe schwarzer Figuren soll darauf aufmerksam machen, dass das Auge angezogen wird. (Im Zusammenhang mit Abbildung 5 und 6 zu sehen.)5) Die verfremdeten Buchstabenzwischenräume werden in der untersten Reihe lesbar («WÜRFEL»).6) Die Intention beim Betrachten dieser gut lesbaren Reihe verhält sich polar zu derjenigen bei Abbildung 4.
Blicken wir jetzt auf die Gestaltzeilen der Abbildung 5. Auch hier wird auf den ersten Blick die gleiche Erfahrung wie vorher zu machen sein. Bemüht man sich aber, hier den Hintergrund ins Auge zu fassen, also die Zwischenräume zwischen den dunklen Gestalten intentionell zu ergreifen, kann man in der untersten Zeile zuerst darauf aufmerksam werden, dass sie eine lesbare Schrift ist. Einmal darauf aufmerksam geworden, fällt es leicht, sie ins Auge zu fassen. Je ähnlicher von Zeile zu Zeile die Zwischenräume den Buchstaben werden, umso leichter gelingt der Intentionswechsel. Die oberste Zeile der Abbildung 5 enthält noch dunkle Gestalten auf hellem Grund, die unterste dagegen helle Buchstaben auf dunklem. Irgendwo in der Mitte «flimmert» der Übergang. Kann man die Schrift der Zwischenräume gut lesen, versuche man anhand von Abbildung 6, sich darüber klar zu werden, ob jetzt immer noch die schwarzen Gestalten schneller «ins Auge fallen» als der Schriftzug der hellen Zwischenräume. Wer gut beobachtet hat, wird gefunden haben, dass es lediglich leichter ist, die helle Schrift als Ganzes ins Auge zu fassen als die dunklen Gestalten als Ganzes. Denn es ist auch weiterhin leichter, eine einzelne dunkle Gestalt zu fixieren als einen Zwischenraum. Das hängt damit zusammen, dass wir beim Lesen auch nie einzelne Buchstaben bewusst ergreifen, sondern immer die zu Worten geordneten Buchstabengruppen. Auf diese Art sind wir gewohnt, unsere Vorstellungen an der Schriftwahrnehmung zu bilden. Daher ist es der Denksinn, der den Bedeutungsinhalt der Schrift auffasst und die Tendenz des Gestaltsinns überspielt, kleine dunkle Gestalten auffassen zu wollen. Er fördert die Intention, auf das Ganze der Zwischenräume den Blick richten zu wollen. Wir bemerken an diesem Zusammenhang, dass mehr als nur unsere bewusste Führung der Sinne in der Wahrnehmung arbeitet.

Der Denksinn kann also, wie unser Experiment gezeigt hat, den Gestaltsinn zwingen, gegen seine Eigentendenz zu arbeiten. Er ist dem Gestaltsinn übergeordnet. Es zeigt sich an diesem Experiment, dass wir mit Recht bisher drei Sinne im Sehfeld unterschieden haben: den Sehsinn, der «hell – dunkel» wahrnimmt; den Gestaltsinn, der Buchstaben wahrnimmt, und den Denksinn, der Bedeutungen auffasst.
Das Lesen als Fähigkeit muss erworben werden. Ein Analphabet wird zu einem anderen Ergebnis kommen als ein Mensch, der lesen kann, wenn er die Abbildungen 4, 5 und 6 betrachtet. Daher muss der Denksinn ein erworbener Sinn sein. Angeboren ist selbstverständlich die Fähigkeit, ihn auszubilden, das Wie seiner Ausbildung aber hängt vom Schicksal jedes einzelnen Menschen ab. Das gilt auch für den Gestaltsinn. Er wird allerdings früher erworben als der Denksinn. Der letztere ist das Ergebnis der Schulbildung, der erstere das Ergebnis der Erziehung im ersten Lebensjahrsiebt.
Mit den folgenden Experimenten kann die Fähigkeit, Gestalt- und Denksinn zu unterscheiden, geübt werden.
Vexierbilder – vor Jahrzehnten ein beliebter Zeitvertreib – haben es mit dem Gestaltsinn zu tun. Sie sind so angelegt, dass es ihm schwerfällt, die versteckte Gestalt zu entdecken. Einmal gelungen, «sieht» der Gestaltsinn zum Beispiel Jäger und Hasen sofort. (Die) Abbildung (7) bietet Gelegenheit zu entdecken, was sich in diesem Vexierbild versteckt. (Von Karl Bauer «Wo ist Schiller»):

Escher ist ein Künstler, der dem Gestaltsinn in seinen Zeichnungen mehrere Zugriffsmöglichkeiten bietet. Dabei arbeitet er oft mit mehreren Perspektiven so, dass der Betrachter seinen Beobachtungsstandort zu wechseln scheint, wenn er einmal von unten, ein andermal von oben auf die dargestellten Objekte blickt. Die Abbildungen 8 und 9 geben zwei Arbeiten von ihm wieder, die es gestatten, den Gestaltsinn auf die vielfältigste Art eingreifen zu lassen.


Durch die Übung an den beiden Graphiken Eschers ist zu erfahren, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, mit dem Gestaltsinn in das Material des Sehsinns einzugreifen, wenn es sich dazu eignet. Wir betrachten, um diese Möglichkeit weiter zu prüfen, Abbildung 10, die ein reguläres Hexagon darstellt, dessen Ecken durch drei Diagonalen verbunden sind. Diese zweidimensional erscheinende Gestalt kann intentionell als Ganzes ins Auge gefasst werden.
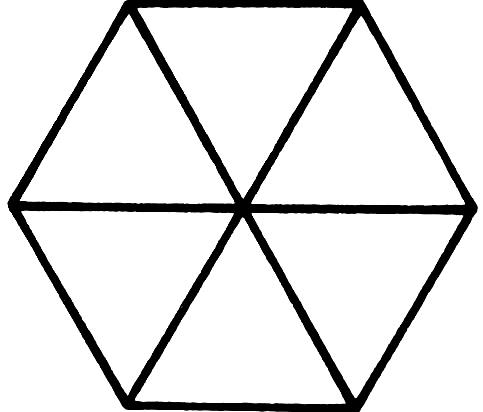
Die Intention kann aber auch auf Teile der Gesamtgestalt gerichtet werden; die Figuren 1 bis 15 von Abbildung 11 zeigen es. Blickt man mit dieser Intention auf Abbildung 10, wird jeweils etwas anderes sichtbar. Die Figuren 1 und 2 geben an, wie sich je drei Dreiecke zusammenfassen lassen. Dieses Experiment lässt sich auch so variieren, dass man den Dreiecken eine Richtung gibt, im Sinne der Figuren 3, 4 und 5. So können die Dreiecke gegeneinandergerichtet (3), gleichgerichtet (4) und auseinanderstrebend (5) wahrgenommen werden.
Ausser Gruppen von Dreiecken lassen sich auch alle möglichen Linienzüge herausgreifen. Beispiele geben die Figuren 6-9 an. Schliesslich lässt sich Abbildung 10 auch als räumlicher Würfel sehen, und zwar aus sechs verschiedenen Ansichten. Hierfür geben die Figuren 10-15 an, mit welcher Intention auf Abbildung 10 zu blicken ist. Die punktierten und die schraffierten Linien sind Hilfsmittel, die Intention zu verdeutlichen.
Auch durch diesen Versuch zeigt sich, dass wir zumindest mit zwei Sinnen gearbeitet haben: nämlich mit dem Sehsinn, der das in allen Fällen gleichgebliebene «hell- dunkel» wahrnimmt, und dem auf verschiedene Weise eingreifenden Gestaltsinn.
Dass der Gestaltsinn, wenn er einen Würfel aus Abbildung 10 auffasst, mehrere Würfel sehen kann, hängt damit zusammen, dass dieser Zeichnung Momente fehlen, die in Wirklichkeit vorhanden sind: beispielsweise eine opake, strukturierte Oberfläche, verschiedene Beleuchtungsverhältnisse der sichtbaren Seiten, eine Unterlage, auf der der Würfel steht, Perspektive und so weiter. Wirkt das alles im Sehfeld zusammen, arbeitet der Gestaltsinn auch wirklichkeitsgemäss. «Wirklichkeit» soll hier die sich allen unseren Sinnen offenbarende Natur genannt werden.
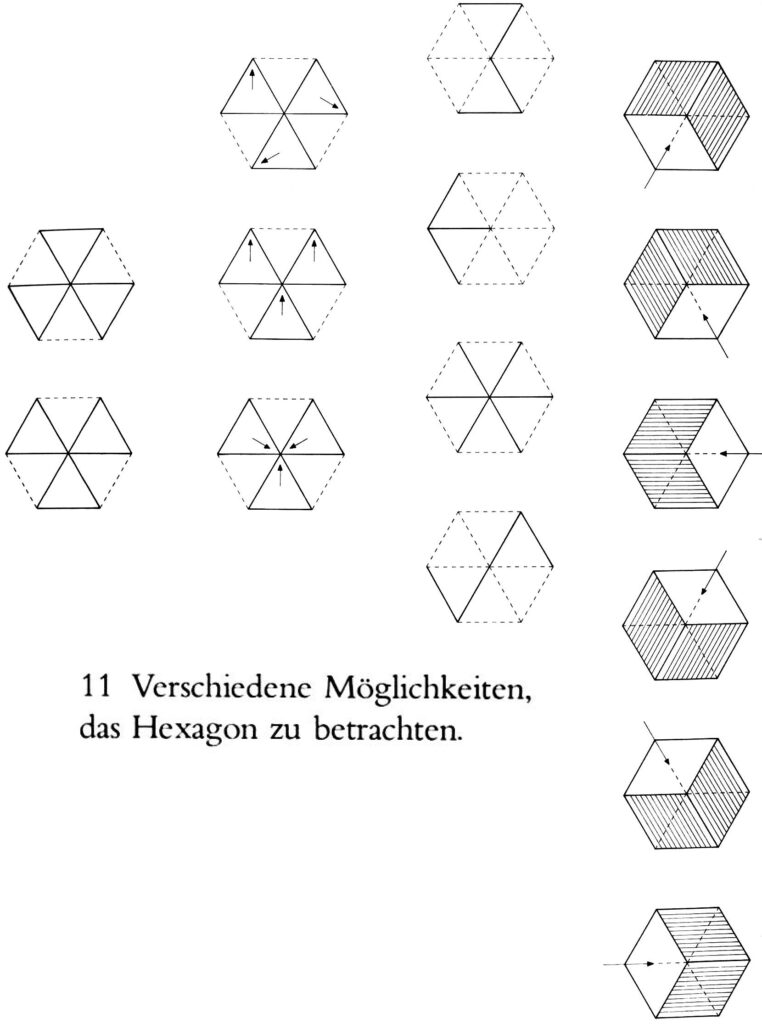
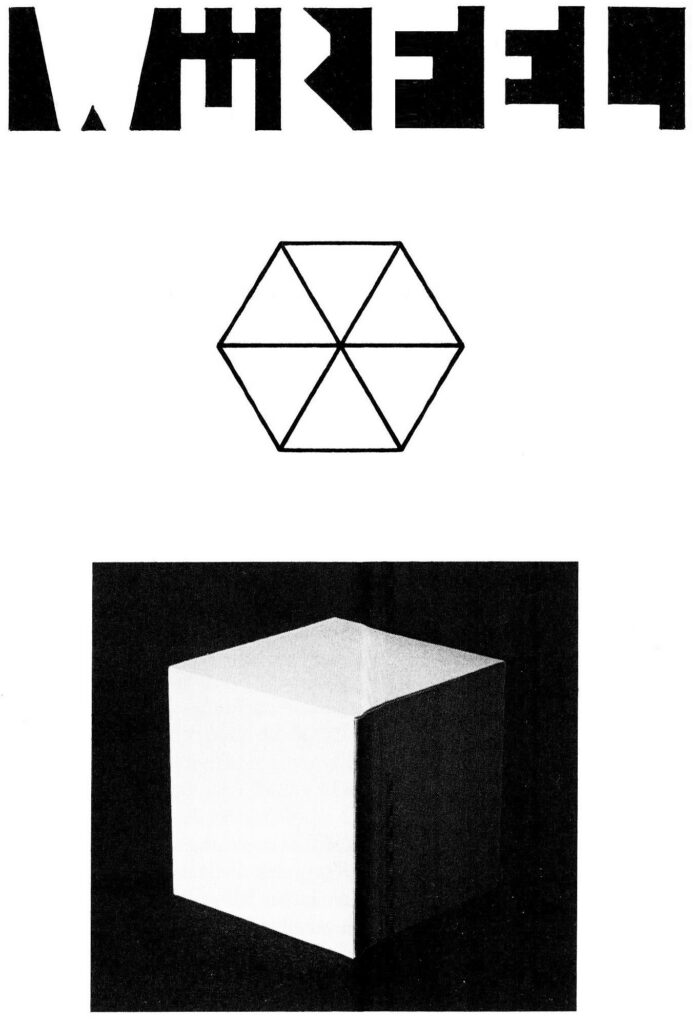
Wir haben, wenn wir die gesamte Reihe unserer Experimente mit «Würfel» betrachten, Bilder zunehmender Wirklichkeitssättigung vor uns. Wir fassen sie noch einmal in Abbildung 12 zusammen: den Schriftzug « Würfel», die Würfeldarstellung aus regulärem Hexagon mit Diagonalen und das Foto eines Holzwürfels. Wir haben damit eine Reihe gefunden, von der Schrift bis zum Foto eines Holzwürfels. Halten wir fest, was sich dabei in der Wahrnehmung verändert und was gleichbleibt. Eine vollständig andere Wahrnehmung liegt von Schritt zu Schritt für den Sehsinn vor. Das «hell- dunkel» aller drei Figuren von Abbildung 12 ist vollkommen verschieden. Für den Gestaltsinn liegt in der Schrift etwas anderes vor als in Zeichnung und Foto des Würfels. Das Foto bietet ihm nur eine Zugriffsmöglichkeit, die Zeichnung dagegen lässt sechs Varianten zu. Lediglich für den Denksinn liegt kein Unterschied vor. Er kann denselben Begriff aus der Schriftgestalt, der Zeichnung und dem Foto auffassen. Allein für den Denksinn ist es also gleichgültig, durch welche Vermittlung anderer Sinne er tätig wird, keinesfalls aber für den Menschen als ganzes Sinneswesen. Lässt der Mensch seinen Sinnesorganismus durch den Denksinn führen, und dazu drängt die heutige intellektuelle Erziehung, legt er gar Intention in diesen Sinn, so wird er immer weniger darauf achten, ob seine Wahrnehmungsinhalte wirklichkeitsgesättigt sind oder ob sie sich an ein zunehmend abstrakteres Material halten. (Man mache sich einmal klar – von diesem Gesichtspunkt aus ist dies übersehbar -, worin der Unterschied zwischen Film- und Theatererlebnis besteht, und man wird einen ersten Hinweis darauf erhalten, wie weit wir schon in Surrogaten leben.)
Die in Abbildung 12 dargestellte Reihe lässt sich in zwei Richtungen einen Schritt weiterführen: einmal können wir vom Lesen des Wortes «Würfel» zum Hören übergehen und zum anderen vom Betrachten des Fotos zum Anblick eines realen Holzwürfels. Im gehörten Wort und im gesehenen Objekt haben wir den grössten denkbaren Gegensatz vor uns. Empfindungsmässig halten wir das gesprochene Wort für angemessen, um mitzuteilen, wie wir mit dem Würfel im Denken umgegangen sind. Der gesehene Würfel dagegen fordert, wenn man sich mit ihm beschäftigen will, zur Beschreibung seines Seinscharakters auf: zum Beispiel ein Würfel aus Holz mit einer speckigen Oberfläche, die ziemlich glatt ist. Die Maserung wechselt die Färbung, sie hat helle und dunkle Zonen und so weiter. Das gehörte Wort «Würfel» könnte in diesem Sinne die Bemerkung veranlassen, dass der Würfel nur in der Idee vollkommen sein kann, dass alle seine räumlichen Erscheinungen der Idee nie vollkommen entsprechen können. Das Sehfeld wendet sich mehr der Erfahrung der Welt zu, das Hörfeld mehr der Auffassung von Ideen. Die Schrift nähert sich innerhalb des Sehfeldes stark dem Charakter des gehörten Wortes.
Bei der Betrachtung der Sinnesphänomene, die sich an den Hörsinn und an den Sehsinn jeweils anschliessen, haben wir am Beispiel «Würfel» eine Phänomenreihe gefunden, die das Hörfeld mit dem Sehfeld verbindet. Diese Reihe zeigt, dass es der gleiche Sinn ist, der aus den Grundlagen, die ihm der Hörsinn oder der Sehsinn liefert, Gestalten bildet. Sein Entdecker, Rudolf Steiner, hat ihn «Lautsinn» genannt, ein Sprachgebrauch, der aus der Beobachtung dieses Sinnes im Hörfeld stammt.
Fragen wir nun nach den Urphänomenen, die sich aus der Tätigkeit des Gestalt(Laut)sinnes im Sehfeld ergeben, so wie wir die Tätigkeit des Lautsinnes im Hörfeld untersucht und dabei die den Lautgestalten zugrunde liegenden sechs urphänomenalen Lautgruppen zum Spektrum geordnet haben. Dabei ist es wichtig, sich darauf zu besinnen, dass die «ebenen Flächen» – aus denen die meisten Gestalten zusammengesetzt sind – nur die von der Technik hervorgebrachte Welt erfüllen; in der Natur treten sie allein im Mineralreich auf – und da sind sie zumeist im Inneren der Gesteine in Klüften und Drusen verborgen und kommen in der Regel nur durch menschliche Tätigkeit ans Licht. Die Oberflächen, die die Gestalten der belebten Natur zeigen, bestehen nicht aus ebenen Flächen. Es sind die Wachstumsprozesse, die den Raum der lebendigen Gestalten bilden.
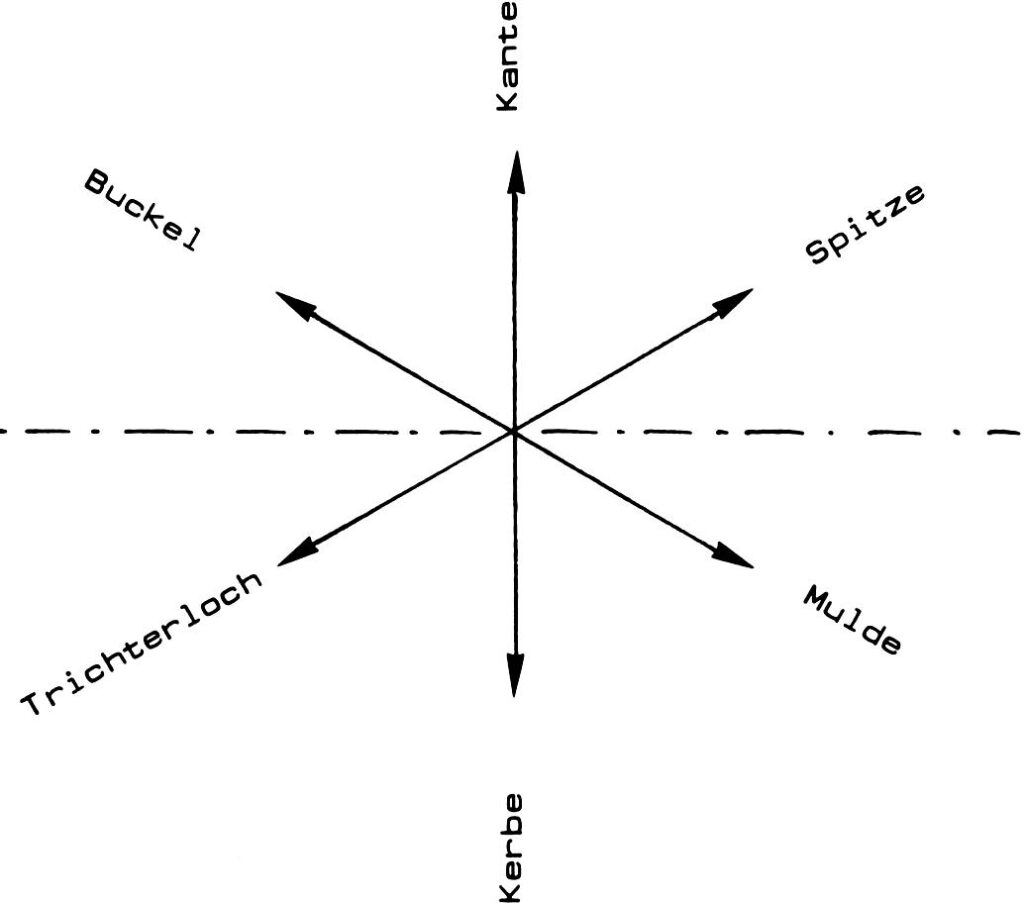
Diese von innen wirkenden Prozesse bringen gebuckelte oder gemuldete Oberflächen hervor. Dabei ist es oft so, dass die Buckel in einer Richtung eine stärkere, in einer anderen Richtung eine weniger starke Krümmung aufweisen. Fehlt die Krümmung in einer Richtung ganz, so haben wir eine einfach gekrümmte Fläche vor uns. Die ebene Fläche erscheint von dieser Sicht als die Nivellierung von Buckel und Mulde, sozusagen die Niederung zwischen beiden Bildungen. Wo sich buckelige und gemuldete Flächen begegnen, entstehen Kanten oder Kerben. Beide, Kanten wie Kerben, sind eindimensionale, Buckel und Mulden dagegen zweidimensionale Bildungen. Können Gestalten auch zum Dimensionslosen, zum Punktuellen streben? Diese Tendenz finden wir an kegel- oder trichterartig gebildeten Flächen, die einer Spitze zustreben. Aus den aufgezählten sechs Urphänomenen bilden sich alle Gestalten des Sehfeldes.
Spektrum des Laut- oder Gestaltsinnes im Sehfeld:
Der Denksinn
Der Denksinn
Dass wir die Gedanken anderer Menschen auffassen können, indem wir zuhören oder lesen, ist uns selbstverständlich. Weniger selbstverständlich ist, dies als Sinnestätigkeit zu begreifen. Im Abschnitt über den Gestaltsinn haben wir am Beispiel «Würfel» gesehen, dass Wortgestalt und Bedeutungsinhalt zwei verschiedene Qualitäten sind und daher von zwei Sinnen wahrgenommen werden müssen. Nun soll versucht werden, die verschiedenen Bedeutungsinhalte der Sprache zu gliedern.
Beginnen wir mit dem Beispiel «Würfel». Das Wort hat substantivische Bedeutung. Ein rein begrifflicher Inhalt wird dadurch ausgedrückt, unabhängig davon, ob diesem Begriff in der Sinneswelt eine Erscheinung zukommt oder nicht. Dem Substantiv «Würfel» kann natürlich eine Erscheinung zukommen, nicht so dem Morgensternschen Begriff «Nasobem». Die durch Substantive erzeugten Vorstellungen schildern uns, um «was» es sich handelt, nicht aber, «wo» sie als Dinge zu finden wären, auch nicht, ob es sie wirklich gibt, wie «Nasobem» zeigt.
Eine weitere Bedeutungsart zeigt sich, wenn uns ein Wort eine Tätigkeit nennt, also zum Beispiel «würfeln». Auch hier wird in uns eine inhaltliche Vorstellung erzeugt; soweit ist diese Bedeutungsart der substantivischen vergleichbar. Die Tätigkeitsform dagegen ist ihr polar.
Eine dritte Inhalte erzeugende Bedeutungsart ist die adjektivische beziehungsweise adverbiale, zum Beispiel «würfelig». Sie bildet insofern zwischen den beiden erstgenannten eine Mitte, alssie eine substantivische wie eine verbale Bedeutung modifizieren kann, ja ihren Gebrauchswert erst durch diese Eigenschaft erhält. «Würfeliger» Tisch ist eine Modifizierung eines Substantivs, «würfelig» (im Sinne von kubistisch) modellieren eine Modifizierung eines Verbs.
Neben diesen drei Bedeutungsarten von Worten, denen gemeinsam ist, dass sie uns einen Inhalt nennen, gibt es weitere, die hinweisenden Charakter haben. Wenn jemand mit dem Zeigefinger auf einen Würfel deutet und «dieser» spricht, wird dadurch beschrieben, um welchen konkreten Würfel es sich handelt. «Diesen» beschreibt hinweisend die Gegenwärtigkeit einer konkreten Sache.
So haben beispielsweise die Demonstrativpronomen generell hinweisende Bedeutung, ja sie deuten über die Sprache hinaus in die Tatsächlichkeit. Eine zweite Art in der Gruppe der hinweisenden Bedeutungen findet man, wenn beobachtet wird, welche Bedeutungsart sich am Ende des folgenden Satzes entwickelt: «Der Würfel, vom Beile getroffen, er zerbricht unter dem schmetternden Hieb». Der erste Satzteil baut eine Vorstellung auf, die unter der Wirkung dessen, was das Personalpronomen «er» in die Bedeutung hereinträgt, vollständig zurückgedrängt wird, um eine andere erscheinen zu lassen. Im Gegensatz zur hinweisenden Bedeutung bleibt die zurückdrängende in der Vorstellung stehen und weist nicht über die Sprache hinaus.
Die mittleren Verhältnisse finden wir, wenn der Gebrauch eines Artikels betrachtet wird. «Der Würfel rollt über den Tisch». «Der» vergegenständlicht den Begriff Würfel zu einem auf dem Tisch rollenden Objekt. Dieser Gebrauch des Artikels weist uns auf eine Sache; insofern ist die «vergegenständlichende Bedeutungsweise» der hinweisenden ähnlich. Sie bleibt aber in der Vorstellung, ohne über die Sprache hinauszuweisen, und zeigt dadurch ihre Verwandtschaft mit der zurückdrängenden.
Wir haben bisher auf der Inhalte nennenden wie auf der auf Dinge hinweisenden Seite der Bedeutung je drei Arten gefunden, wie die Worte gebraucht werden, die wir auf die folgende Weise nebeneinandersetzen, um zu zeigen, dass es zwei weitere Bedeutungsarten gibt, die beide Seiten verbinden:
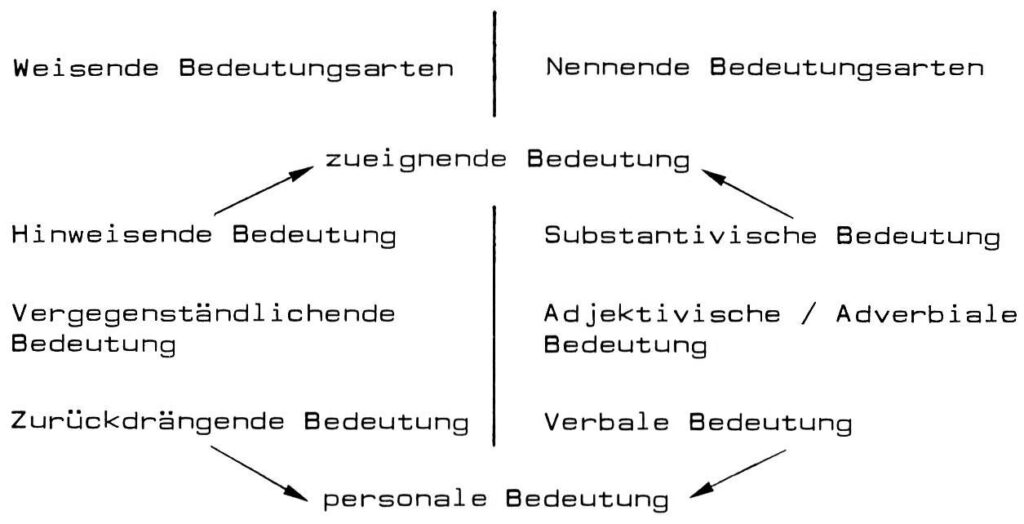
Die Personalpronomina ich, du, er und so weiter rufen einen bestimmten Inhalt hervor, aber nicht allein, sondern erst durch den Sprachkontext, in dem sie stehen. Sie haben primär weisenden Charakter, dieser erhält aber erst seinen Inhalt durch Worte nennender Bedeutungsart. Diese beiden Seiten des Spektrums verbindende Bedeutungsart soll «personale Bedeutung» genannt werden.
Schliesslich seien noch die Eigennamen betrachtet. Sie verbinden die beiden Seiten des Spektrums, denn ein Eigenname ist ein reiner Begriff, aber ein solcher, der als konkreter, bestimmter und einmaliger in der Welt enthalten ist. Ohne einen vorangestellten Artikel wird damit auf die Person hingewiesen. Das Bedeutungsfeld der Eigennamen sei «zueignende Bedeutung» genannt.
Damit ist nicht alles aufgenommen, was an Bedeutungsarten durch die Grammatik beschrieben wird. Bei dem Vorgebrachten handelt es sich um einen anfänglichen Versuch, auch diesen Problemkreis mit unserer phänomenologischen Methode anzugehen. Die Fruchtbarkeit dieses Hinweises müsste erst durch eine phänomenologische Grammatik erwiesen werden.
Durch den Denksinn nehmen wir die seelische Tätigkeit des Menschen wahr, die er als denkendes Wesen vollbringt; mit dem entwickelten Schema haben wir allerdings nur das Modell eines konkreten Spektrums der Denktätigkeit vor uns, nach dem die einzelnen Spektren gebaut sind.
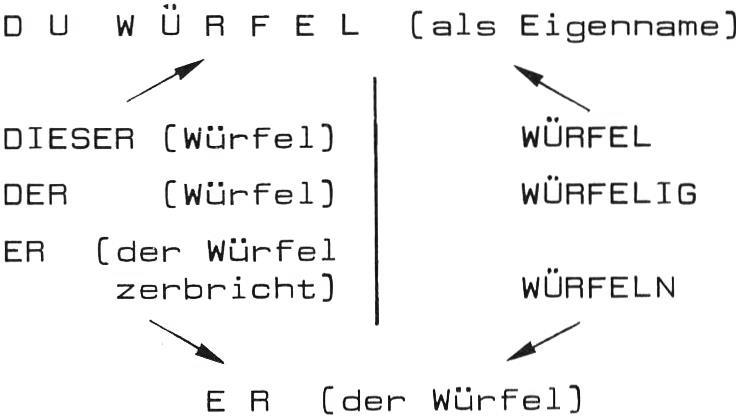
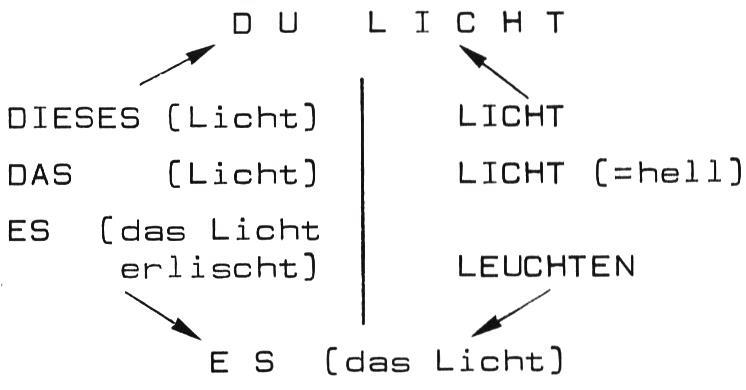
Was steht als einheitliches Ganzes hinter dieser sechs-(acht-)fachen Einkleidungsform in den Denkgebrauch? Dieses Ganze muss einer Welt angehören, aus der es in vielfacher Weise Objekt der Denktätigkeit werden kann und deshalb alle Formen, in denen es seelisch erscheinen kann, in sich enthält. Es ist die Welt der Ideen, wo es ein wirkendes Wesen ist. In dieser Welt selbst kann es als Imagination erlebt werden. Somit gibt es so viele Einzelspektren des Denksinnes wie Imaginationen.
Wenn der Denksinn die Seeleninhalte und Tätigkeiten des Denkens auffasst – welcher Welt gehört dann das Wort an, das als Vermittler sich unterscheiden lassen muss von den Inhalten und Tätigkeiten, die es zur Erscheinung bringt? Der Hörsinn nimmt die Äusserungen der physischen Welt auf, denn physikalische Verhältnisse bestimmen Tonhöhe, Tonstärke und Tonlänge. Die Denkfähigkeit, die der Denksinn abbildet, gehört der Seelenwelt an. Alle Gestalten, die die Erde hervorbringt, entwickeln sich durch die Zeitprozesse der lebendigen Welt. Wie werden die Wortgestalten gebildet? Sind die Lautgestalten ebenso Bildungen eines Ätherleibes, wie es die Gestalten der Pflanzen, Tiere und Menschen sind? Sind die Gestalten, die die Erde trägt, das makrokosmische Wort, das Urbild des mikrokosmischen Menschenwortes?
Die Kraft des Willens, die sich der Muskulatur der Brustregion bedient, nimmt die Luft der Lunge als Material und trägt sie durch die beiden folgenden Regionen der Sprachorganisation: zunächst durch den Kehlkopf, der ihr Stimme verleiht. Am stärksten stimmhaft werden die Vokale gebildet, sie sind damit auch Ausdruck der Kräfte, die im Kehlkopf arbeiten: der Kehlkopf ist das mittlere, gefühlsartige Glied der Sprachorganisation. Das Gefühl ergreift den Kehlkopf als Werkzeug und im Luftstrom ertönt der sinnliche Ausdruck des Gefühls in der Art der Stimmhaftigkeit, des Sonantischen. Die Sprachwerkzeuge des Mundes bringen durch die Stellung von Lippen, Zähnen, Zunge und Gaumen diejenigen von aussen wirkenden räumlichen Begrenzungen dem stimmhaft gewordenen Luftstrom entgegen, die zu den verschiedenen Lautgestalten der Sprache führen. In dieser begrenzenden Tätigkeit zeigen die vorderen Sprachwerkzeuge ihren Denk- oder Kopfcharakter, der dazu führte, dass ursprünglich Wörter gebildet wurden, die sich besonders als Träger von Gedanken eigneten. Es sind die drei Grundkräfte der Seele, die in den Zeitrhythmus der Atmung eingreifen und ihm die Kräfte zutragen, die er zur Bildung der Lautgestalten braucht. Das dafür notwendige physische Werkzeug (Lunge und Lungenbewegungsapparat, Kehlkopf und vordere Sprachwerkzeuge) ist ebenfalls dreigliedrig gebildet. Analoge Verhältnisse finden wir auch in der Pflanzenwelt. Die dynamischen, willenshaft wirkenden Kräfte erhält das dem wässrigen (kolloidalen) Zustande immanente Leben von der Erde: es sind die Nährstoffe, es ist der Humus, der ganze Boden, der der Pflanze die Substanzen gibt, die sie für die Ausfüllung ihrer Gestalt braucht. Dem mittleren Element entspricht hier das Wasser, in das die Erdsubstanzen aufgenommen, nach oben getragen werden und dessen Kräfte die breiten Rundungen aus den Blattanlagen hervorbringen. Begrenzend und gestaltend wirkt das Licht ebenso von aussen wie die Sprachwerkzeuge des Mundes. Die Blüte als reines Ergebnis der Lichtwirkung ist das am meisten ausgestaltete Organ der Pflanze, zugleich das mit den geringsten Lebenskräften ausgestattete. In der Blüte muss die Pflanze sterben, so wie auch der fertig gebildete Laut verklingt.
Der menschliche Kulturprozess des Sprechens erweist sich aus dieser Betrachtungsweise als ein kleiner Bruder des grossen Schöpfungsprozesses, der die lebendigen Gestalten der Welt hervorgebracht hat. Allerdings ist der Substanzzustand nach oben gehoben: das Schöpfungswort wurde in das Wasser gesprochen, das Menschenwort gestaltet die Luft. Der Ätherleib des Menschen bringt in der Sprachorganisation unter der Wirkung der drei Seelenkräfte die Luftgestalten hervor. Der pflanzliche Ätherleib entwickelt die Gestalt aus dem wässrigen Element, ebenfalls unter der Wirkung dreier Kraftpotentiale. Hörsinn, Lautsinn und Denksinn offenbaren dem Menschen die physische Welt, die Lebens- und die Seelenwelt im Kleide zunehmend vorstellungsartig werdender Erfahrungen.
Der Ichsinn
Der Ichsinn
Mehr oder weniger bewusst hat jeder den Sinn für die Wahrnehmung des Stils ausgebildet, in dem die Menschen seiner Umgebung sprechen. Auch am Stil zu denken nimmt man Menschen wahr, die man kennt. Viele soziale Vorurteile knüpfen sich an die Gewohnheit mancher Menschen, die verschiedensten Gedanken mit Denkfiguren einzuleiten, die, weil zur Genüge bekannt, Antipathie hervorrufen. Im Gehen, überhaupt in der Art sich zu bewegen, im Sprechen und im Denken bildet jeder Mensch einen für seine Persönlichkeit typischen Stil aus, der wahrnehmbar ist. Schon als Kind lernt man beispielsweise am unterschiedlichen Knarren der Holzstiege erkennen, wer sie betreten hat. Den Stil eines Menschen erlebt man im ganzen seiner Gedankenführung, im ganzen seiner Sprache und im ganzen seiner Bewegungsart, darin jeweils das Einheitliche auffassend, was diesen Stil ausmacht. Das aber ist ein Problem des Wiedererkennens. Das Wiedererkennen einer Persönlichkeit hat den tätigen Denksinn, dieser den Lautsinn, und dieser den Hörsinn zur Voraussetzung. Der Lautsinn fasst die verschiedenen Schall- oder Geräuscherlebnisse zur Gesamtheit des Lautes oder der Lautfolge zusammen. Der Denksinn fasst die verschiedenen Lautgestalten zur Ganzheit eines Bedeutungsinhaltes zusammen und der Ichsinn die Folge der Bedeutung zur Ganzheit eines Stils. Wir sehen: der Laut-, der Denk- und der Ichsinn arbeiten integrierend und setzen einander so voraus wie der Lautsinn den Hörsinn. Damit haben wir einen charakteristischen Unterschied gefunden, der die drei Sinne Laut-, Denk- und Ichsinn von allen anderen unterscheidet. Alle anderen neun Sinne sondern primäre Qualität in die Empfindungsseele ein, während jene sekundäre Phänomene schaffen. Der zweite charakteristische Unterschied besteht in der Tatsache, dass die drei integrierenden Sinne erworben werden (siehe Denksinn). Angeboren ist nur die Anlage für ihre Ausbildung. Die Ausbildung selbst hängt davon ab, ob wir Gelegenheit bekommen, den Lautsinn zu entwickeln. Weil alle Sprachen dieselben Laute verwenden – von wenigen Besonderheiten wie den Klick- und Schnalzlauten abgesehen -, werden wir durch diesen Sinn Teilnehmer an der Menschheit. Insofern wir den Denksinn entwickeln, werden wir Teilnehmer an dem Volk, dessen Sprache wir erlernen. Durch die Entwicklung eines Stils aber werden wir individuelle Persönlichkeiten.
Aber nicht nur individuelle Stile werden gebildet, es kann auch sein, dass der Stil, den ein Mensch zum Beispiel als Künstler oder als Denker prägt, in späteren Zeiten erkennen lässt, dass darin der Geist eines Volkes oder der Geist einer Zeitepoche mitgewirkt hat. Besonders in den Alten Kulturen ist es so, dass der individuelle Anteil – über die Renaissance, die römische und griechische Kultur – immer geringer wird und in der ägyptischen ganz verschwindet, während Volks- und Zeitgeist zunehmend deutlicher prägend tätig sind. – Damit haben wir sechs Arten gefunden, wie Stil erscheinen kann: drei Arten zeigen sich, wenn das menschliche Ich die Leiblichkeit als Werkzeug ergreift. Hier äussert sich der Stil im Gehen, Sprechen und Denken.
Drei weitere Arten sind zu entdecken, wenn wir auf die Kulturwerke blicken, die Menschen geschaffen haben. Hier äussert sich der Stil als ein persönlich-individueller, zugleich offenbart er den Volksgeist und den Zeitgeist. Wir können damit ein allgemeines Spektrum des Ichsinnes entwerfen, durch den wir das Stilmässige auffassen:
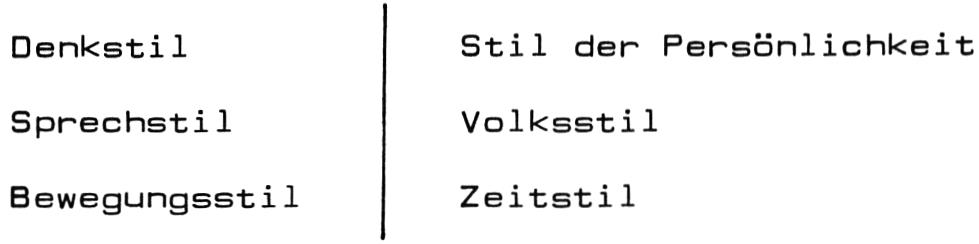
Jeder Mensch entwickelt durch seine Persönlichkeit mehr oder weniger vollständig ein solches Spektrum. Es gibt daher so viele Spektren, wie es menschliche Persönlichkeiten gibt. Die Besprechung des Ichsinnes wäre unvollständig, würden wir ihn nicht an einem Beispiel üben. Hierfür betrachte man die Abbildung und lese erst dann weiter, wenn man zu einer Wahrnehmung der Persönlichkeit des Künstlers gekommen ist, dessen Werk man betrachtet.
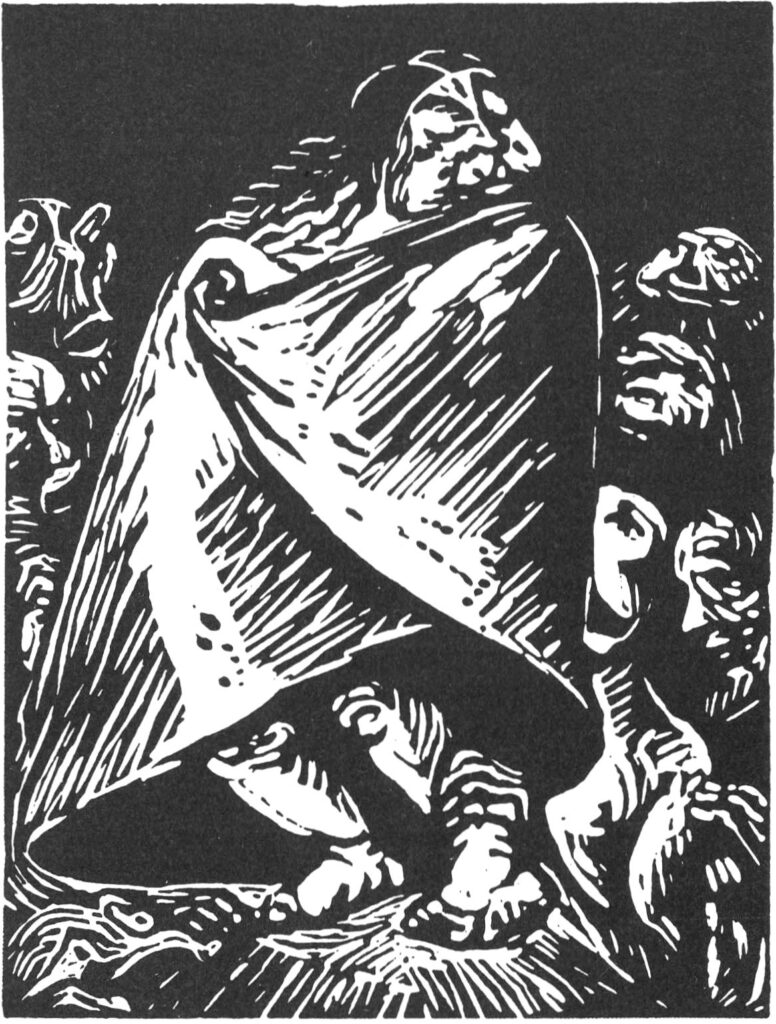
Es handelt sich um einen sehr bekannten Künstler, aber um ein eher unbekanntes Werk von ihm. Wer den Künstler kennt, nicht aber das abgebildete Werk, und seine «Handschrift» darin wiederentdeckt hat, kann sich sagen, dass dieses Wiedererkennen damit zusammenhängen muss, dass er einen Sinn für diesen Künstler früher schon entwickelt hat.
Gemeint ist nicht, dass man sich ein Urteil bildet, wer der Künstler ist, sondern, wer auf der Buchseite die Handschrift von Ernst Barlach «sieht», betätigt seinen «Barlach-Sinn». Schliesslich sei die Arbeit von Ernst Barlach dazu verwendet, uns zusammenfassend über das Zusammenspiel von Ichsinn, Denksinn, Laut- oder Gestaltsinn und Sehsinn aufzuklären: der Sehsinn bringt als angeborener Sinn das Hell-Dunkel in seiner Verteilung auf der Fläche zur Erfahrung. In das Material, das der Sehsinn liefert, greifen die drei anderen Sinne ein. Deshalb soll der Sehsinn «Grundlagensinn» genannt werden. Der Gestaltsinn ergreift die in den Mantel gehüllte Gestalt. Der Denksinn hat es möglicherweise am schwersten: er ergreift die «Schneckenhexe» (es handelt sich um eine entsprechende Illustration zum zweiten Teil des «Faust» von Goethe). Der vierte Sinn ergreift «Barlach». Nun soll keinesfalls gesagt werden, dass mit Hilfe des «Barlach-Sinnes» diese Arbeit als Kunstwerk zu erfassen sei, sondern im Gegenteil: der Ichsinn ergreift den Menschen, der dieses Werk geschaffen hat.
Wir haben uns schon darüber verständigt, dass der Mensch den Lautsinn im ersten und den Denksinn im zweiten Jahrsiebt seines Lebens ausbildet. Die unbegrenzten Urphänomene des Ichsinnes, also den Sinn für jeden einzelnen Menschen, bildet jeder Mensch im Laufe seines ganzen Lebens aus. Schliesslich verfügt man über so viele urphänomenale Spektren des Ichsinnes, wie man Sinne für einzelne Persönlichkeiten entwickelt hat.
Wenn wir Hör-, Laut- oder Gestaltsinn, Denk- und Ichsinn zusammenfassend betrachten, lässt sich sehen, dass sie besonders mit dem wachen und bewussten Teil des Menschenwesens zusammenhängen. Mit dem Denksinn nehmen wir wach wahrnehmend am Seelenleben eines anderen Menschen teil und mit dem Ichsinn erfahren wir sein geistiges Wesen im Abdruck, wenn wir es uns bewusst machen.
Zusammenspiel und Ganzheit der 12 Sinne
Zusammenspiel und Ganzheit der 12 Sinne
Versuchen wir die drei Gruppen von Sinnesfeldern in ihren Eigenarten noch deutlicher zu fassen. In den unbewusst arbeitenden Sinnen, Tast-, Gleichgewichts-, Bewegungs- und Lebenssinn, lebt der Mensch mit seinem Willen. Wir kennen die Tatsache, dass wir intentioneIl mit diesen Sinnen sehr wach wahrnehmen können, aber jenseits des intentionalen Zugriffs bleiben sie mehr oder weniger nur mit dem Willen verbunden. Die Tatsache dass wir den Übergang von der Unaufmerksamkeit zur Aufmerksamkeit bei ihnen so radikal erleben, zeigt die Primärverbindung dieser Sinne zum Willen, mit dem der Mensch durch sie in das Sein der irdisch-stofflichen Welt, in die Kräfte, die mit dem Innern der Erde zusammenhängen, in die Schwere, in die Härte des Stoffes hineinragt. Wir können diese Sinne daher Willenssinne nennen.
Mit dem Geschmacks-, Geruchs-, dem Seh- und dem Wärmesinn ist das Fühlen aufs engste verknüpft. Wir haben bemerkt, dass besonders bei Geruchswahrnehmungen die seelische, sympathische oder antipathische, Reaktion so dominant ist, dass es dem intentionalen Zugriff schwerfällt, den Inhalt der Wahrnehmung selber zu finden. Durch diese Sinne ist der Mensch mit der umgebenden Natur verbunden, insofern sie dem Kosmos entstammt. Licht und Farbe, Wärme, Süsse und Duft sind Qualitäten, die sich in der Natur unter der Wirkung der Sonne entwickeln. Diese Sinne bleiben ohne intentionalen Zugriff nicht ganz unbewusst wie die Willenssinne; in den seelischen Reaktionen auf ihre Wahrnehmungen träumt man mehr oder weniger. Wir nennen sie Gefühlssinne.
Im Hörsinn, im Laut- oder Gestalt-, im Denk- und Ichsinn lebt der Mensch auch ohne besonderen intentionalen Zugriff wach. Ja, die Gedanken- und Bedeutungswahrnehmung geht dauernd in Vorstellungs- und Urteilstätigkeit über. Es ist schwer, sicher zwischen dem zu unterscheiden, was in der eigenen Seele an vorstellender Tätigkeit entsteht, und dem, was durch die Sinne in sie eintritt, solange man darin nicht eine gewisse Übung erreicht hat.
In der Tätigkeit des Denksinnes unterscheiden sich die Menschen stark voneinander, da die Art, wie jeder Mensch seine Begriffe entwickelt, und das Lebensgebiet, dem sie entstammen, diesen Sinn ausbilden. Nur die durch Erziehung, Ausbildung und eigene Arbeit erworbenen Begriffe werden auch zu Wahrnehmungswerkzeugen. Das gilt auch für den Ichsinn.
Wer mehr oder weniger selbstbezogen lebt, hat einen Sinn für andere Menschen nur fragmentarisch entwickelt. Lebe ich in diesen Sinnen nicht wach, so sind sie auch nicht so tätig, dass ich durch sie in der Welt stehe. Trotzdem bleiben sie deshalb nicht wirkungslos. Sie fangen an, ähnlich wie die Willenssinne zu wirken, und werden zu Krankheitsursachen. Dass sie tiefer in die Organisation des Leibes wirken als in die Kopforganisation, ist ihnen nicht angemessen. Sie sollen Denksinne genannt werden. Mit den drei Bezeichnungen Willens-, Gefühls- und Denksinne schliessen wir uns dem Sprachgebrauch von Rudolf Steiner an.
Die Bezeichnung «Hörfeld» wurde gewählt in Hinblick auf das integrierte Zusammenspiel, das sich ergibt, wenn der Laut- oder Gestaltsinn wie der Denk- und Ichsinn in den Hörsinn als Grundlagensinn eingreifen.
Genauso ist es auch mit dem, was wir «Sehfeld» nennen können. Hier ist der Sehsinn der Grundlagensinn, in den der Gestalt- oder Lautsinn wie der Denk- und Ichsinn so eingreifen, dass entsteht, was wir vor Augen haben. Nun sind es, wenn man näher nachforscht, nicht nur Laut-, Denk- und Ichsinn, die im Hör- und besonders im Sehfeld arbeiten. Weitere Sinne treten hinzu, die das Erlebnis bereichern und vervollkommnen. Dafür sollen einige Beispiele genannt werden. Es gibt Gründe für die Annahme, dass es das Zusammenspiel von Bewegungssinn und Gleichgewichtssinn ist, das in die Tonwahrnehmung eingreift, wenn ein bestimmter Ton bei getretenem Pedal auf dem Klavier wiederholt angeschlagen wird. Die beiden Sinne erfassen, was man Rhythmus nennen kann; Rhythmus lebt im Zeitrnass und in der Klangstärke der Anschläge. Aber Farbwahrnehmung als unmittelbares Sinneserlebnis oder Geschmacks- und Geruchsnuancen fehlen dem Hörfeld. Auch Wärmewahrnehmungen, Schwere oder Frische sind nicht zu entdecken. Wenn ein Hammer auf den Amboss fällt, erlebt man im Hörfeld durchaus die Härte des Metalls. Der Tastsinn arbeitet mit.
Die drei integrierenden Sinne arbeiten mit dem Material des Sehsinns ebenso sicher wie mit dem des Hörsinnes. Wenn wir auf den Geruchs-, Geschmacks- und Wärmesinn achten, die zusammen mit dem Sehsinn die Gefühlssinne darstellen, kann man unsicher im Urteilen werden. Ein Beispiel für den Wärmesinn: wenn wir bei schönem Sommerwetter, uns selbst warm fühlend, über einer Sandfläche die Luft flimmern sehen, ist die Wärmewahrnehmung durch das Auge zu bestätigen. Aber: ist es der Wärmesinn, der hier arbeitet? Ein Beispiel für den Geschmack: wenn eine rosafarbene Fläche betrachtet wird, hat man durchaus den Eindruck «süsslich», aber um ein unmittelbares Geschmackserlebnis kann es sich nicht handeln. Das Problem, das einer Bearbeitung bedarf, soll später wieder aufgegriffen werden (siehe Seite 104).Die Willenssinne arbeiten im Sehfeld mit. Durch den Bewegungssinn können wir jede ausserhalb unseres Leibes stattfindende Bewegung in voller Wachheit wahrnehmen. Sehen wir ein Bild schief hängen, nehmen wir das mit dem Gleichgewichtssinn wahr. Ein Blick auf einen Menschen genügt, um zu sehen, ob er schläfrig oder wach ist, sich frisch oder matt fühlt. So ist es auch mit dem Tastsinn. Wir sehen einer Oberfläche an, ob sie rauh oder glatt beschaffen ist.
Das Hörfeld vermittelt uns die Welt so, dass die Seele mit dem Denken unmittelbar an dieses Feld anschliessen kann. Wie im Denken fliesst auch hier die Zeit von der Vergangenheit in die Gegenwart. Das Sehfeld vermittelt uns bild- oder tableauhaft die Welt so, dass die Seele fühlend unmittelbar anschliessen kann. Dabei erleben wir die Raumeswelt so, dass sie uns mit ihren Oberflächen vor Augen steht. Gibt es nun noch ein drittes Feld, in dem ein Willenssinn der Grundlagensinn ist, der von den integrierenden Sinnen ebenso ergriffen wird wie der Sehsinn aus der Gruppe der Gefühlssinne und der Hörsinn aus der Gruppe der Denksinne, so dass die Seele ein drittes Mal mit dem Wollen unmittelbar anschliessen kann? Versuchen wir auf dieses Feld aufmerksam zu werden, indem wir die Augen und die Ohren verschliessen. In diesem Zustand haben wir durchaus eine Wahrnehmung von uns selbst und von der Welt. Können die Erfahrungen der Zustände des eigenen Leibes wahrgenommen werden? Die Wahrnehmungen durch den Tast-, den Gleichgewichts- und den Lebenssinn, auch die Wahrnehmung der Lage der Glieder, unser Gehen und Stehen, die Wärmewahrnehmung, selbst das Riechen und Schmecken, ändern sich nicht. Dahingegen verwandelt sich die Wahrnehmung der Umwelt vollständig. Ich bin zu einem isolierten Wesen geworden, und meine Wahrnehmungsfähigkeit endet an meiner Haut. Ich «weiss» noch, dass ich eine Umwelt habe, bin aber vollkommen unsicher, wie weit beispielsweise die Dinge von meiner tastenden Hand entfernt sind. Die Unsicherheit wächst, je näher mir die Dinge sein müssen. Die vorsichtig ausgestreckte Hand erwartet die Berührung der Zimmerwand; im Moment der Berührung fährt das Sicherheitsgefühl durch den ganzen Körper. Besonders schön ist dieses Erlebnis morgens beim Aufwachen zu haben. Voraussetzung dazu ist, dass man den Aufwachvorgang so miterlebt, dass man wach wird, bevor man sich aktiv bewegt hat. Man bleibe mit geschlossenen Augen liegen und frage sich, welche Lage zu Bett und Schlafzimmer man einnimmt. Man sagt sich zum Beispiel: wenn ich mit dem Kopf zum Kopfende meines Bettes gerichtet auf der linken Körperseite liege, so muss die Zimmerwand vor mir sein, das Fenster hinter mir. Die Lage zu allen anderen Einrichtungsgegenständen vergegenwärtige man sich, wenn man nun mit der Frage in sich hineinhorcht, ob diese Vorstellung, die man sich so ausgemalt hat, auch das Erlebnis der Wirklichkeit enthält, über die man spekuliert hat. Man muss die Frage verneinen. Hat man Zweifel am Wirklichkeitscharakter der Vorstellungen, weil man sich sagt, vielleicht habe man sich im Schlaf mit dem Kopf zum Fussende gedreht, so dass man die Wand nicht vor, sondern hinter sich habe, so strecke man einen Finger aus und bewege ihn in die Richtung, in der die Wand erwartet wird. In der Regel trifft man auf sie genau im erwarteten Moment. Jetzt fährt die Gewissheit von der Wirklichkeit der Welt, in der wir sind, wie ein Schlag in einen hinein. Alle Zweifel sind fort, und die Wahrnehmung der Lage im Raum ist da, verbunden mit dem Sicherheitsgefühl «auf der Erde zu sein». In diesem Moment ist der Mensch in sein «Tastfeld» eingetaucht. Das Tastfeld vermittelt das Erlebnis, wirklich auf der Erde zu sein, dadurch, dass der Wille hier unmittelbar anschliessen kann.
Falls es sich dabei um ein «Feld» im Sinne von Seh- und Hörfeld handelt, müssten auch die integrierend arbeitenden Sinne unmittelbar im Tastfeld tätig sein können. Dass es so ist, zeigt der Versuch. Man lasse sich mit verbundenen Augen zum Beispiel eine Plastik auf den Tisch stellen. Versucht man, durch tastende Wahrnehmungen mit Fingern und Händen zu einer Gestalterfahrung zu kommen, so ist das nur von einiger Schwierigkeit, weil der Gestaltsinn hier ungeübt ist. Ein Blinder verschafft sich mit diesen Mitteln seine Gestaltwahrnehmungen. Damit soll nicht gesagt sein, dass die Gestaltwahrnehmung des Blinden völlig identisch mit der eines sehenden Menschen sei – das ist sie nicht. Aber die Gestaltwahrnehmungen hat der Blinde durch seine für den Gestaltsinn sensibilisierten Hände. Entsprechend ist es auch mit dem Begriffssinn. Auch er kann ins Tastfeld eingreifen. Einen Tisch oder Stuhl wird man mit tastenden Händen wahrnehmen können. Wer der Ungeübtheit oder der Grösse der Objekte wegen Einwände hat, der mache sich klar, dasser solche Schwierigkeiten auch aus dem Sehfeld kennt. Man erinnere sich nur an Sichtverhältnisse bei Nebel und nehme ein kleines Objekt, zum Beispiel eine Glühbirne, weil man sie mit beiden Händen so umfassen kann, dass die Hände auf ihrer Oberfläche nicht bewegt werden müssen, um ein deutliches Gestalterlebnis zu haben. Dazu bemerkt man durch den Wärmesinn den Unterschied zwischen dem Glas- und dem Metallteil der Glühbirne, nämlich «glatt», beziehungsweise «feinrauh». Soll der Unterschied zwischen dem Gestalt- und Bedeutungserlebnis beim Tisch und der kleinen Birne beschrieben werden, so hat – wegen der verlaufenden Zeit, in der die tastende Hand über die Flächen, Kanten und Winkel des Tisches streicht – die Erfahrung mehr den Charakter des Hörfeldes, die auf der Birne ruhende Wahrnehmung mehr den des Sehfeldes. Wir müssen aber hinzufügen, dass die Tätigkeit der drei integrierenden Sinne hier keine Voraussetzung dafür ist, dass die Seele mit dem Willen unmittelbar an das Tastfeld anschliessen kann. Der Wille greift in die Grundlagensinne der Sinnesfelder ein. Das Denken greift in die integrierenden Sinne eines Sinnesfeldes ein, und das Fühlen hält zwischen beiden Polen eine Mitte.Wir haben drei Felder entdeckt, auf denen die Sinne so zusammenarbeiten, dass ein Sinn zum Arbeitsmaterial für drei integrierende Sinne wird; er wurde Grundlagensinn genannt. Die drei integrierenden Sinne sind erworben, und nicht angeboren. Es sind der Laut- oder Gestaltsinn, der Denk- und der Ichsinn. Die drei Seelenglieder des Menschen schliessen auf eine dreifach verschiedene Art so an die Sinnesempfindungen an, dass der Mensch als denkendes, fühlendes und wollendes Wesen sich mit der Welt und seiner eigenen Leiblichkeit so verbinden kann, dass er sich in einer wirklichen, mit ihm verbundenen und sinnerfüllten Welt, in der Natur erlebt. In diesem dreimal vierfachen Zusammenspiel besteht das Sinnesleben, das alltäglich unser Sinnesbewusstsein erfüllt. Wer sich Rechenschaft darüber geben will, worin auch nur eine einzige Minute seines Lebens in der Sinneswelt bestanden hat, der wird finden, dass es sich um das harmonische Zusammenwirken all dessen handelt, wovon wir hier gesprochen haben. Das Erlebnis, in der Wirklichkeit unserer irdischen Welt zu stehen, hängt davon ab, dass auf allen drei Sinnesfeldern, dreifach mit der Seele verknüpft, eine Erfahrung der gleichen Objekte zustande kommt, um im wahrnehmenden Bewusstsein zu einem einzigen ganzheitlichen «Erfahrungsfeld» zu verschmelzen. Damit haben wir zu unserem Ausgangspunkt, dem naiven Sinneserleben, zurückgefunden und Begriffe entwickelt, die es erklären können. So bleibt uns, das ganze Problem der Sinneslehre abschliessend, noch die Frage, ob es ebenso eine Ordnung der zwölf Sinne gibt, wie die einzelnen Sinne eine Ordnung ihrer Spektren zeigen.
Zusammenhang der Sinne mit den Wesensgliedern des Menschen
Zusammenfassung
Die Willenssinne: Tastsinn, Lebenssinn, Bewegungssinn, Gleichgewichtssinn
Mit dem Tastsinn erleben wir die physikalischen Eigenschaften der Welt. Mit dem Lebenssinn nehmen wir wahr, wie der Erhaltungs- und der Ernährungsprozess unseres Ätherleibes im physischen Leibe arbeiten. In der Bewegung lebt das Seelische, insofern es einem physischen Leibe immanent ist. Im Gleichgewichtssinn lebt das Ich des Menschen. Durch seine Tore tritt es am Morgen in den Leib ein und verlässt ihn beim Einschlafen wieder. Jeder der vier Willenssinne ist also für die Wirkungen einer der vier Wesensschichten der Natur offen: so der Tastsinn für die physische Leiblichkeit, der Lebenssinn für den Ätherleib; der Bewegungssinn erfasst die Seelenschicht, und die Wahrnehmung des Gleichgewichtssinnes braucht das Ich, wenn es sich in sein rhythmisches Verhältnis zu Leib und Kosmos bringt.
Die Gefühlssinne: Geruchssinn, Geschmackssinn, Sehsinn, Wärmesinn
Durch den Geruch nehmen wir die physische Stofflichkeit wahr, die unter der Wirkung des Seelischen und des Ätherleibes steht. Aasgeruch und Blütenduft sind hier die Pole. Im Geschmack nehmen wir die Stoffe wahr, in denen der Ätherleib tätig ist. In der Vielfalt der Geschmacksarten erleben wir die Frucht lebendiger Tätigkeiten, die Fülle, die der grosse Chemikator Ätherleib aus (gar nicht so vielen) Grundstoffen zu Kohlehydraten, eiweissartigen Substanzen und zu Fetten aufbereitet hat. Jede Pflanzenart ist an den Geschmackskompositionen ihrer Substanz zu erkennen.
Farben treten überall dort auf, wo das Seelische sich selbst darstellt. In den Himmelsfarben erscheint das Seelische am reinsten im Bilde. Blütenfarben erscheinen durch seelische Kräfte, die aus dem Umgebungsraum wirken.
Von den beseelten Wesen sind es Schmetterlinge, Schnecken, Reptilien und Vögel, die Farbenpracht entfalten, weil bei ihnen das wirkende Seelische noch nicht ganz ins Leibesinnere eingezogen und zum Verhalten (Bewegung) geworden ist. In der Wärme, deren Zustände wir durch den Wärmesinn erfahren, lebt das Ich des Menschen und entfaltet seine Wirksamkeit auf den physischen Leib. Die Wärmeorganisation hat im wachen Tagesleben einen konstant warmen Kern im Inneren und einen kühleren variablen Mantel. Tendenziell kehrt sich dieses Verhältnis in der Nacht um. Der Kern wird kühler, der Mantel wärmer. Hier bringt das Ich seinen Rhythmus zur Geltung.
Die Denksinne: Hörsinn, Laut- oder Gestaltsinn, Denksinn, Ichsinn
Durch das Hören offenbaren sich die physikalischen Eigenschaften des Materials, seine Härte, Elastizität und seine Grösse. Der Ätherleib bringt im Wachstum die Gestalten hervor, die der Gestaltsinn auffasst, und der Mensch wiederholt in den Lautgestalten, die er ausspricht, das Weltenwort. Dem Denksinn offenbart sich die menschliche Seele in ihrer Denktätigkeit. Im Ichsinn lebt eine unmittelbare Wahrnehmung des anderen Ich, insofern es als geistiges Wesen Stil in die Welt bringt (siehe folgende Schemas).
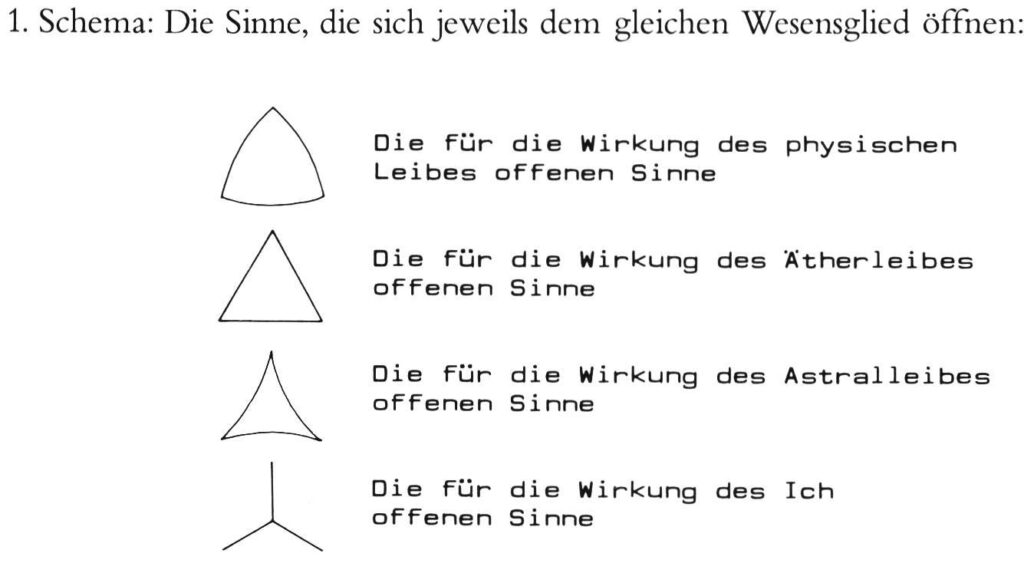
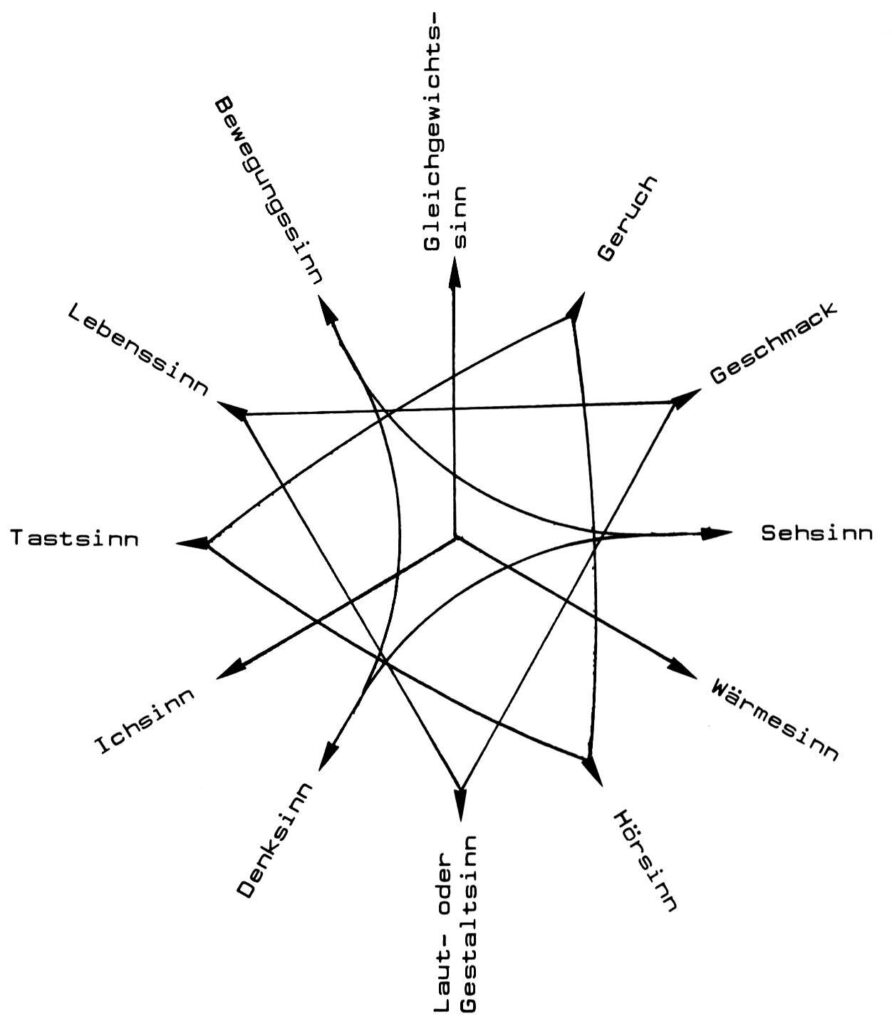
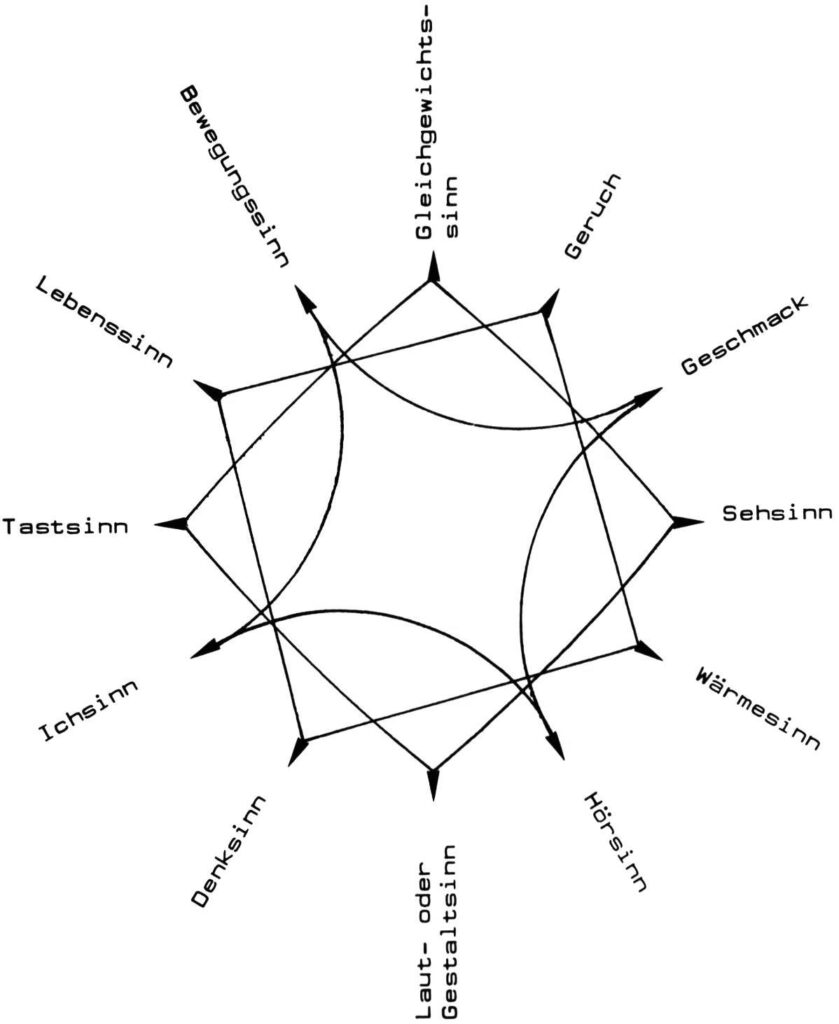
Zu einer vollständigen Sinneslehre würde eine Betrachtung der Sinnesorgane gehören. Eine solche müsste einmal morphologisch und ein andermal physiologisch durchgeführt werden. Beide Betrachtungsarten wären durch eine Funktionslehre mit der hier behandelten psychologischen Seite des Gesamtproblems zu verbinden. Diese reizvolle Aufgabe überschreitet aber unser Thema. Wir beschränken uns auf den psychologischen Gesichtspunkt, soweit er dargestellt wurde. Von hier aus soll auf den Gebrauch der Sinne in Wissenschaft und Kunst übergegangen werden. Den Unterschied vor Augen zu haben, wie Wissenschaft und Kunst mit den Sinnen umgehen, ist die Voraussetzung, um das Besondere der Kunst würdigen zu können.
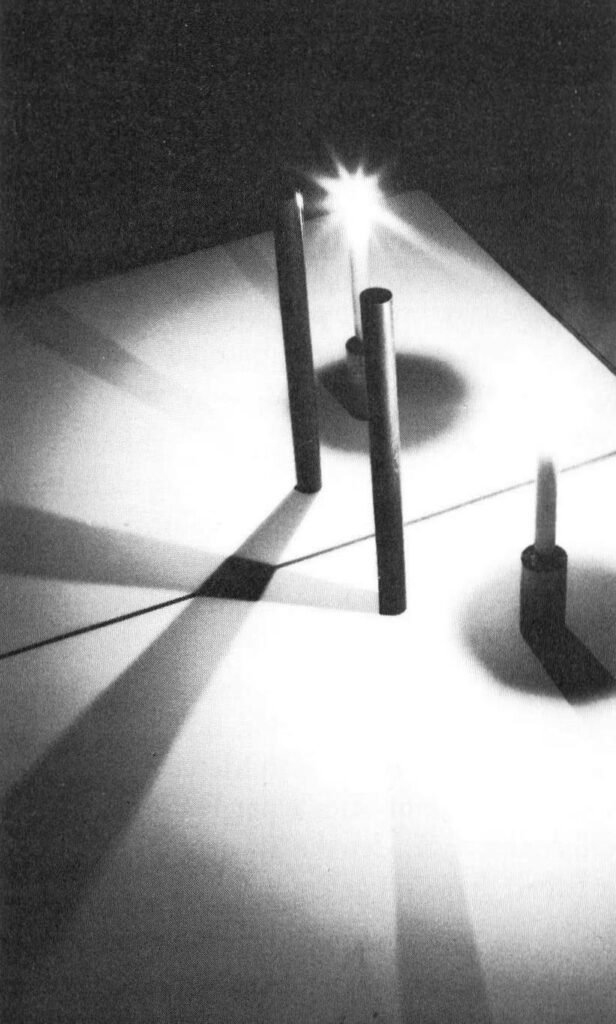
Der Einstieg soll durch ein Experiment eröffnet werden, das die Folgen zeigt, wenn Teile des Erfahrungsfeldes ausfallen. Man betrachte das Foto (Abb. 14). Man erkennt zwei Kerzen, die zwei Rundstäbe so beleuchten, dass sich zwei der vier Schatten überschneiden. (Die zugrunde liegende Anordnung stammt von dem Waldorflehrer Frits Julius). Diese Abbildung ist dadurch zustande gekommen, dass eine einzige Kerze einen einzigen Stab vor einem Spiegel beleuchtet. Wir haben nur zur einen Hälfte ein wirkliches, zur anderen aber ein Spiegelbild vor uns. Man wird einwenden können, dass das tatsächliche Experiment – im Gegensatz zu unserer Abbildung – die Grenzen des Spiegels erkennen lassen wird. Das ist wahr, aber der Einwand macht auch deutlich, worin das Täuschende unserer Abbildung besteht. Es fehlen den Willenssinnen alle differenzierenden Zugriffsmöglichkeiten. Sobald das Experiment in einem einigermassen beleuchteten Raum aufgebaut und die Gesamtsituation übersehbar wird, ist ein grosser Teil der Ungewissheit dadurch verschwunden, dass der Gestaltsinn den Spiegel ausgliedern kann. Er ersetzt jetzt die Willenssinne. Baut man sich dieses Experiment auf und blickt durch einen einengenden Kasten oder ersetzt eine ganze Zimmerwand durch einen Spiegel, stellt sich dieselbe Ungewissheit ein wie gegenüber dem Foto. Diese verschwindet vollständig, wenn man mit dem Finger die Spiegeloberfläche berührt. Nicht nur das Tasterlebnis, auch der sichtbare Fingerabdruck hilft die Illusion fortzuschaffen. Wir sehen daraus, wie leicht es ist, die Realität der irdischen Sinneswirklichkeit zu verlieren, wenn Teile des Erfahrungsfeldes ausfallen. Sowohl die Wissenschaft wie die Kunst zerlegen die Sinneserfahrung und arbeiten mit je verschiedenen Teilen derselben. Dadurch müssen sie, und zwar notwendigerweise, den verbliebenen Rest ergänzen, wenn Neues gewonnen werden soll. In beiden Fällen muss das Ergebnis etwas anderes sein als das naive Naturerlebnis. Was es ist und wohin die beiden Wege führen, soll im folgenden anzudeuten versucht werden.
Der Gebrauch der Sinne in der Wissenschaft
Wie verhält sich eine auf Erfahrung aufbauende sachgemäss arbeitende Naturwissenschaft zu den Sinnen? Für die Bearbeitung einer solchen Frage muss das dazugehörige Tatsachenwissen, soweit es erkundet ist, vollständig vorliegen. Worin es prinzipiell zu bestehen hat, muss für jede wissenschaftliche Fragestellung beantwortet sein. Zum Beispiel für die Pflanzenmorphologie gehört die mit Hilfe eines Stereomikroskopes gewonnene Kenntnis der sich entwickelnden Primärstadien dazu.
Ist eine Frage gestellt und wird nach der Antwort gesucht, kann von vielen Sinnesqualitäten abgesehen werden, wenn sie die Fragestellung nicht berühren. Fragen wir beispielsweise nach der Gesetzmässigkeit der Formwandlung während der Entwicklung eines Laubblattes, kann man davon absehen, dass das Primärstadium des Laubblattes noch ungefärbt ist, bald zart hellgrün bis gelblich erscheint und später dunkelgrün wird. (Dieses Beispiel ist gewählt, weil wir die in Frage kommenden Tatsachen für die Gartenkresse schon auf Seite 19, Abbildung 2, kennengelernt haben.) Wir können auch davon absehen, welche Tasteindrücke dazugehören, wie es riecht und schmeckt. Ins Auge gefasst wird also allein dasjenige, was der Gestaltsinn aus dem Material des Sehsinnes auffasst. Hat man die Entwicklungstatsachen aller Laubblätter einer Pflanze bis zur Blütenbildung aufgeklärt, besteht die weitere Arbeit darin, den die Tatsachen verbindenden Ideenzusammenhang aufzufinden. Wir haben denkend gefunden, dass die Zeit in diesem Falle kontinuierlich verläuft. Wir haben diesen Zeitfluss mit dem der Laubblattfolge verglichen und festgestellt, dass sich die Zeitrichtung umkehrt. Die zugrunde liegende Denktätigkeit können wir das «begriffliche Verknüpfen der Tatsachen» nennen. Untersucht man in diesem Sinne eine Pflanzenart so, dass man sie zu verschiedenen Jahreszeiten keimen lässt (in mitteleuropäischen Verhältnissen), lernt man durch die Art der morphologischen Änderung auch kennen, welche auslösenden und wirkenden Ursachen aus der Umwelt mitgewirkt haben. Man wird finden, dass bei vielen Pflanzen die Tageslänge einen entscheidenden Einfluss hat. Auch Wärme, Wasser- und Bodenverhältnisse entfalten ihre Wirksamkeit. So lernt man ein Naturgesetz kennen, in diesem Falle die Gesetzmässigkeit der Formwandlung der Laubblattfolgen der Pflanzenarten. Das Ergebnis kann man als Idee der Laubblattmetamorphose in Worte fassen. Voll verstanden ist sie aber erst, wenn aus ihr auch hervorgeht, warum die Bäume nur eine geringe oder gar keine Gestaltwandlung zeigen oder warum die Orchideen niemals gegliederte Spreiten tragen. Zur Entwicklung eines solchen Wissenschaftsbildes gehört eine lange Lebenserfahrung im Umgang mit der bearbeiteten Tatsachenwelt und der Ideenbildung daran. So hat man schliesslich die Fähigkeit erlangt, mit einer Idee praktisch arbeiten zu können. Man hat gelernt, sie auf neue Erscheinungen anzuwenden und kann die besondere Art, in der die Idee hier oder dort in Erscheinung tritt, unmittelbar anschauen. Man hat gelernt, die weiterführenden Fragen zu stellen.
Auf diese Weise gelangen wir aus der Welt der Sinne in die Welt des Geistes, die aber in die Erscheinungen der Natur ergossen ist und ihr als hervorbringende Kraft zugrunde liegt. Je weiter die Begriffe mit der Natur übereinstimmen, umso wirklichkeitsgemässer wird die Erkenntnis. Ich kann erkennend aus ihr handeln und sie mir im Kleide des besonderen Falles vorstellen. In diesem Sinne konnte Goethe, wie er sagte, Pflanzen erfinden. Die Natur erfindet keine mehr. Die Zeit ist lange vergangen, als die Natur selbst die Schöpferin war. Wir kommen also zu einer geistigen Welt, deren schöpferische Tätigkeit in der Vergangenheit lag und nachschaffend bis in die Gegenwart wirkt. Wir lernen die Welt kennen, insofern sie Werk der Götter ist, wenn wir von den Naturgestalten und Naturprozessen den Weg zum Geiste suchend im Buche der Natur lesen lernen.
